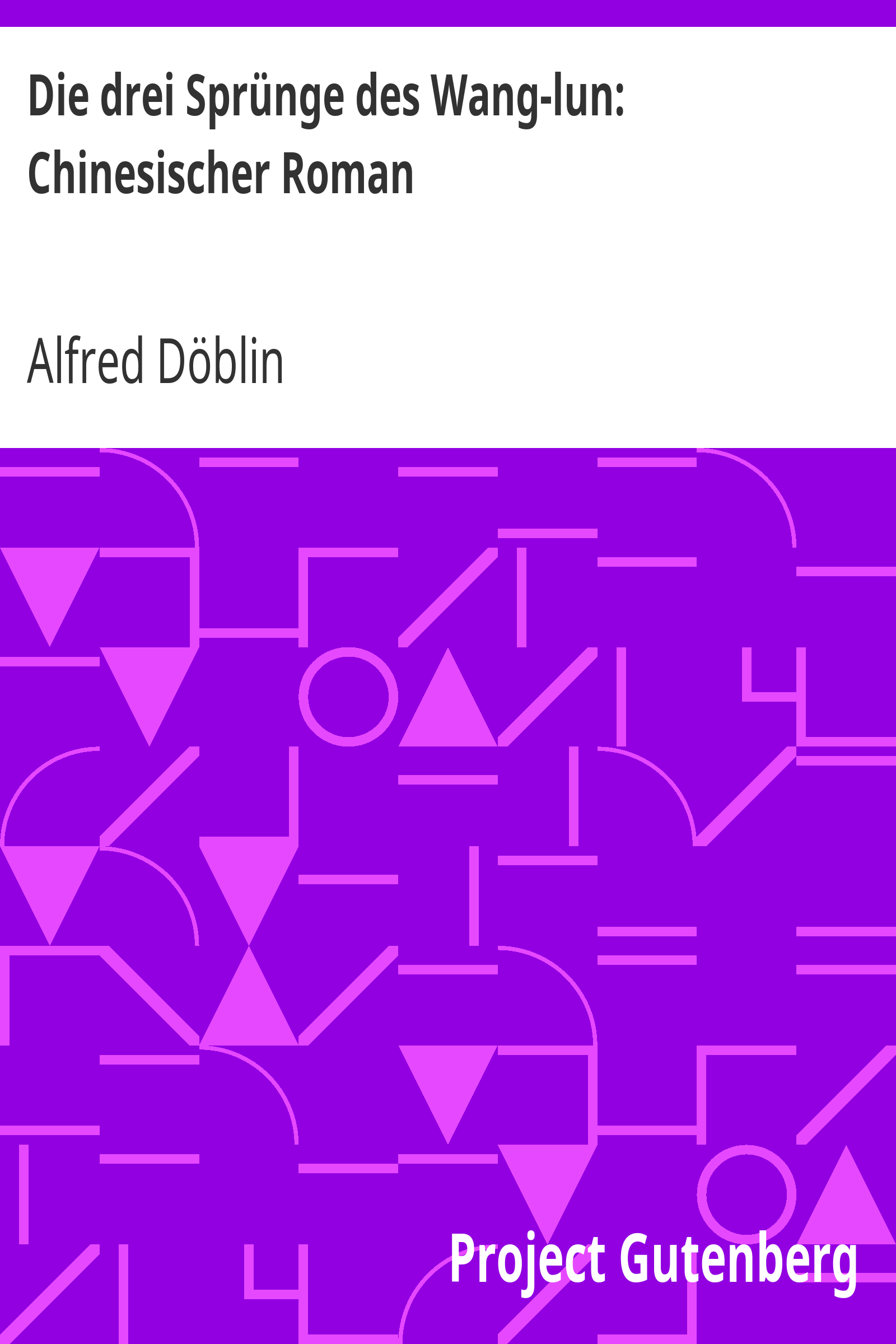Die drei Sprünge des Wang-lun: Chinesischer Roman
Play Sample
Das unsichere Gefühl, daß die Männer, die er führen sollte, mehr von Wang besaßen als er selbst, verließ ihn in den nächsten Wochen nicht. Er war bisweilen nicht zu bewegen, eine Auskunft zu erteilen; es versenkte ihn in eine zahnwetzende Wut; ihm schien, als ob man ihn in Versuchung führen wolle. Man wollte ihm vorhalten, wer er war. Und wieder mußte er sich zwingen und zu seinem Erstaunen gewahren, daß die Brüder an nichts dachten, ihm vertrauten. Ja lächerlicherweise eine Ehrfurcht vor ihm hatten, die sich nicht viel von ihrer Empfindung gegen Wang unterschied. Er antwortete ihnen unter schmerzvoller Hemmung. Sie wollten, so schmählich es war, ersichtlich nichts zwischen ihm und sich; Wang-lun stand nicht zwischen den Bettlern und ihm. Sie boten sich selbst, freiwillig, drängend als Objekte an. Er empfand es als Unsauberkeit, daß er diese Männer anwies, als Schändung Wangs. Mit einer peinlichen gezwungenen Lüsternheit bewegte er sich unter ihnen.
Er gewöhnte sich. Das tägliche Handeln schliff überscharfe Empfindungen ab. Genötigt, sich stündlich zu äußern, zu entscheiden, kam er rasch in die Nähe zu den Brüdern, die sie brauchten, in die des Führers. Er wirkte. Mehr als Nachdenken befreite und löste das. Er schwamm über Widerstände. Er fühlte sich gesättigt, über Zweifel gehoben. Die Stunden von Nan-ku fingen an zu verdunkeln. Hart modellierten die neuen Aufgaben an ihm.
Die Lehre Wangs sprühte Kälte. Manche Charaktere, über die sie zuerst geworfen war, mußten aufs Heftigste gegen sie rebellieren. Ungeschickte, die jede Handfertigkeit verlernt hatten bei ihrem Gewerbe auf Nan-ku, in armen Gegenden nicht das Notdürftigste erbettelten, geschlagen, tagelang eingesperrt wurden: sie fanden sich mühselig, mißmutig zurück, waren schwer zu bewegen, unter Menschen zu gehen. Ihre schiefen Blicke sagten, daß sie bald an die Arbeit gehen würden, die sie gut verstanden. Ma-noh nahm sich ihrer an; es konnte nicht im Plane Wang-luns liegen, die Hände in den Schoß zu legen, unbarmherzig verderben zu lassen. Scharf waren andere zu überwachen: der wanderte freudig herum, zog morgens munter ab, stellte sich abends ein, belebt, vergnügt, zu vergnügt; er hatte einen Sippengenossen in einer nahen Ortschaft gefunden, genoß in Ruhe seine Gastfreundschaft. Ins Riesenhafte wuchs die Arbeit, als der Zustrom schwoll und man kaum erfuhr, wer kam, Namen, Schicksal, ob der Neuling nicht gegen die drei kostbaren Regeln verstoße, die Armut, Keuschheit, Gleichmut, was er erhoffe von dem Bund der Wahrhaft Schwachen. Damals traten ohne weiteres ausgebrochene Verbrecher in den Bund, um sich zu verkriechen; man mußte sie sich vom Leibe halten oder aufnehmen, je nach ihrer Art, verstecken oder verjagen. In dem einen Falle hatte man ihre Rache zu gewärtigen, im andern Nachforschung der Ortspolizei, der Präfekturbeamten. Gelegentlich bemächtigte sich die Polizei kurzweg einiger Männer und Frauen, die sie verdächtigte, Verbrecher zu beschützen.
Es wuchs der „Ring der Frommen“, wie man sich unter den Brüdern ausdrückte. Diese eigentümliche Vorstellung hatte die Masse selbst aufgebracht. Man meinte, man könne allmählich in dem geschlossenen Ring der Wahrhaft Schwachen durch die Gewalt der Versenkung jenes Letzte erreichen, das man bald das Westliche Paradies auf dem Kun-lun nannte, bald den fünften Maitreya, bald das Kin-tanpulver, welches ewiges Leben gewährt.
Ma-noh wurde heftig aus sich herausgerissen. Er wuchs in seine Aufgaben hinein. Schwer gelang ihm die Besinnung auf den Nan-kupaß. Nan-ku war der Geburtsort des Bundes; es waren erst Wochen um, seitdem der Fischersohn aus Schan-tung von dem alten Wu-wei gesprochen hatte. Ma ging straffer in seinem langen geflickten Priestermantel. Sein kleines spitzes Gesicht ähnlich dem Antlitz einer Krähe. Unheimlich lebendig zuckte es über seine niedrige, schrägfliehende Stirn, fuhren Gedanken um seinen liniendünnen Mund. Während er mit mageren Händen gestikulierte, schlangen seine Blicke Taue, die nicht losließen. Er redete hastig wie früher, aber mehr dringend und gehalten. So sah das Boot aus, auf dem viele die Große Überfahrt antraten.
Mit einer Gruppe von zweihundert Männern und Frauen trennte Ma-noh sich von einer nordwärts wandernden. Sie waren nicht weit entfernt von Tschön-ting, einer mittleren Stadt am Huto-ho, dessen Lauf sie dicht von seinem Austritt aus dem Wu-taigebirge gefolgt waren. Ma-noh wollte sehen, möglichst bald südlich von Tschao in die einsame Gegend des Sumpfes von Ta-lou zu kommen. Ihn drängte es aus Gründen, die er nicht faßte, in eine sehr ruhige Landschaft. Bei Tschön-ting vergrößerte sich Mas Gruppe um eine Anzahl Männer und Frauen.
Die junge Frau Liang-li, die gestützt auf zwei Dienerinnen angetrippelt kam, die schönste Frau der Stadt, stammte aus dem berühmten Tseu-Geschlechte, dem unter anderm der große Zensor Tseu-yin-lung angehörte, der zur Zeit des Mingkaisers Schi-tsung wirkte. Frau Liang, als sie noch Mädchen war, hing sehr an ihrem Vater, der hohe Staatsämter bekleidet hatte, dann als reicher Mann in Tschön-ting seinen Ahnen und seiner Familie lebte. Die zarte Mutter Liangs, Tseus rechtliche Frau, kränkelte jahrelang. Die sehr energische Tochter ließ die beiden Nebenfrauen nicht aufkommen, sie besorgte die jungen Geschwister zusammen mit ihren Dienerinnen, stand dem Vater zur Seite in der Verwaltung seiner großen Güter. Tseu liebte sehr seine feine Frau, für deren Heilung er sein halbes Vermögen hingab. Jeder Wu, jeder Exorzist, der neu in die Stadt kam, erfuhr, daß er sich seine ersten Taels bei Tseu verdienen konnte. Ganze Prozessionen veranstaltete Tseu zur Heilung seiner Frau, die zunehmend schwächer und heller wurde, ab und zu tagelang aus Mund und Nase blutete und dabei ängstlich jammerte. Sie blieb auf einmal weg, und kein Brennen der Fußsohle, keine Nadelstiche unter die Fingernägel weckten sie.
Es mag wohl der furchtbare zähe Vampyr, der die Frau aussog, noch nicht genug gehabt haben; jedenfalls wurde der sehr frische Mann, ein vorzüglicher Boxer und Ringkämpfer, nach dem Tode seiner Frau in einer nicht natürlichen Weise traurig. Und es geschah etwas, das über die Tore des Tseuhauses hinaus nicht ruchbar wurde: der Witwer suchte sich in einer Mondnacht, nachdem er seinen Ahnen Kerzen angezündet hatte, in einem kleinen Teich zu ertränken. Unruhig gemacht durch den nächtlichen Kerzengeruch warf sich Liang einen langen Mantel um, rannte vergeblich durch das Haus nach dem Vater, stürzte in den Park. Sie zog den Vater aus dem Teich. Tseu genas völlig unter der Pflege seiner Tochter.
Aber seit dem schrecklichen Ereignis in dem Park veränderte sich sein Verhältnis zu der schönen Liang. Es kam etwas Gedrücktes in sein Benehmen. Er wich ihr aus, hängte sich an die beiden jungen Nebenfrauen, deren Reize der Witwer erst jetzt zu empfinden schien. Der Mann, der in der Mitte der fünfziger Jahre stand, betäubte sich an der Schönheit dieser Frauen. Die Tochter verfolgte ihn. Ihr Haß auf die beiden Frauen schwoll über jedes Maß. Sie verleumdete sie bei Tseu, setzte durch, daß er die jüngere, ein harmloses, sanftmütiges Wesen, verjagte.
Aber es kam nicht zum Frieden. Liang legte die Trauer nicht ab um die Mutter. Sie trug die Halskette, die Perlenschnüre der Toten. Die beiden seidenen Beutelchen, die Lotosblattäschchen hängte sie sich an den Gürtel. Zwei goldene Ringe, zwei silberne Ringe, Verlobungsgeschenke Tseus an seine Frau, nahm sie aus dem Kästchen, schob sie sich über die Finger. Tseu wich aus dem Hause. Er besuchte die Theater, besiegte öffentliche Preisringer. Es sprach sich in der Stadt herum, daß er eine Geliebte in den bemalten Häusern hätte. Ehe es mit ihm zu Ende ging in dieser verzweifelten Weise, erschien sein Bruder, der damals als graduierter Literat in Ta-ming wohnte, in Tschön-ting, um den schlimmen Gerüchten über seinen Bruder nachzuforschen.
Er hielt dem zehn Jahre älteren Mann die Schande vor, die er auf das Tseuhaus werfe, bewirkte bei einer erregten Bootfahrt, daß Tseu zugestand, die Familie an der Aufsicht über die Liegenschaften zu beteiligen, schließlich die verjagte Nebenfrau, die ihm draußen einen Knaben geboren hatte, zur rechtlichen Frau zu erheben. Als die Brüder ernst im Hause erschienen und der schönen Liang dies mitteilten, verneigte sie sich, nachdem sie an ihren Ringen gespielt hatte, vor ihrem Vater, nahm Halskette, Perlschnüre ab, legte sie vor Tseu an den Boden, bat, ihr vor der Hochzeit des Vaters einen Gemahl zu wählen. Das war Hu-tze, der schon nicht mehr hoffte, Liang zu besitzen.
Die beiden Hochzeiten gingen vorbei. Liang wohnte im Hause des Hu-tze, der seine junge Frau innig verehrte. Der kluge kühle Mann vermochte nicht ihr finsteres Wesen zu bannen. Zuerst lebte Liang ganz zurückgezogen und schien gewillt, die Liebe des Hu-tze anzunehmen. Sie gebar ihm aber kein Kind. Da glaubte er, es sei besser, wenn sich Liang in Gesellschaft begebe; auch gewisse Steine vom Wege und Blumen ließ er in ihren Zimmern aufstellen, damit sie sie gelegentlich berühre, denn in ihnen wohnen die Geister ungeborener Kinder. Die junge Frau lachte über alles und folgte ihm.
Sie ging in die Wohnung ihres Vaters. Bei diesem Besuch traf sie ihn nicht an. Sie trippelte in die wohlbekannten Zimmer, nahm aus einem Kasten, den sie aus einer verhängten Truhe holte, die Andenken an ihre Mutter heraus, die Verlobungsgeschenke des Vaters, die Perlenschnüre, das Lotosblattäschchen. Dafür warf sie höhnisch lachend den Stein in den Kasten, den Hu-tze ihr hatte bringen lassen. Sie war viel freudiger in den folgenden Monaten, von einer hinterhältigen samtenen Zutraulichkeit zu dem Mann, dem sie einen Knaben brachte. Beim Anblick des Kindes weinte die schmalwangige Wöchnerin hilflos, verfiel in ein widerspenstiges finsteres Wesen, mit häufigem Schluchzen, Fäusteballen, Wutausbrüchen, daß sie verloren sei.
Sie ließ sich, sobald sie hergestellt war, in das Haus des Vaters tragen. Ohne ihren Gatten zu sprechen, hatte sie sich in Hochzeitsschmuck geworfen, aus Laune, wie sie ihre Dienerschaft beruhigte. Den langen Schleier trug sie, Ringe, Armspangen, Blumen aus Federemail. So trat sie vor ihren Vater, wie ihre Mutter in jungen Jahren anzusehen, im entschlossenen Gesicht die scharfen Züge der Krankheit, verneigte sich und sagte, sie wäre da. Tseu hieß sie willkommen und war entsetzt. Sie nahmen nebeneinander Platz zum Essen.
Liang saß in glücklicher Laune neben ihrem Vater, dem das Herz zu zucken begann, der von Schmerz, Sehnsucht, Grauen zerrissen war. Wie Mann und Frau gingen sie durch die Zimmer; Tseu ließ seine schöne Tochter gewähren; sie umarmte, küßte ihn. Sie umschlang seine Schultern ohne Scham. Sie spazierten durch den dichten Park. Da lief Liang im Gestrüpp ihrem Vater voraus, raffte den grünen Schleier, den sie sich um den Hals wand, warf sich rückwärts, das Gesicht nach dem Vater zu, die Arme gegen ihn aufgehoben, in den Weiher. Tseu brauchte lange Zeit, ehe er mit Hilfe des herbeigeholten Gärtners die Frau herauszog; sie kam nach Stunden wieder zu sich. Sie soll dann ihren Rettern geflucht haben, an der Brust des trostlosen Tseu in Weinen, Vorwürfe und verwirrtes Geschrei ausgebrochen sein. Sie ließ ihn nicht los, bis er sie willenlos umfaßte und unter Küssen flüsterte, er wolle mit ihr sterben. Auf seinem Schoß streckte sie sich im Zimmer; da schloß sie gegen Abend still die Augen, richtete sich auf und sagte abwesend, daß sie nach Hause zu Hu-tze müsse. Die Sänfte Liangs ist nie in den Hof Hu-tzes gekommen. Es kam nur, von einem fremden Läufer getragen, am Morgen ein Brief von ihr bei Hu-tze an, daß sie sich wohl befinde, daß es ihm und seinem Knaben, den zu gebären sie das Glück hatte, wie sie hoffe, auch gut erginge; und sie werde ihm auch in der Zeit zugetan bleiben, wo sie nicht bei ihm wohne.
Dann ist sie, verlockt von der Lehre des Nichtwiderstrebens, zu Ma-nohs Gruppe vor Tschön-ting gestoßen, um arm, keusch und gleichmütig zu leben.
Dies war die schöne Liang-li, die sich im Lager von ihren Dienerinnen trennen mußte. Denn hier war keiner Diener des andern. Sie ging, wie alle lilienfüßigen Frauen, von einigen Männern oder kräftigen Frauen begleitet, zu betteln, singen, Kranke zu heilen.
Frau Ching saß im hohen Kaoliang neben ihr. Dies war eine einfache Gemüsehändlerin, die in äußerlich erträglichen Verhältnissen lebte; sie war seit einem Jahre Witwe, besaß einen größeren Jungen von zwölf Jahren, dazu ein verwachsenes skrophulöses, auch bösartiges Kind. Nach der Geburt des unglücklichen Wesens hätschelte sie ihren älteren Liebling nicht mehr lange. Sie wurde völlig von dem Kinde, das der Vater sein „Großväterchen“ nannte, in Anspruch genommen, je mehr sich seine Eigentümlichkeiten herausstellten. Trotzdem sie überzeugt war, daß die hexende Hebamme an allem schuld hatte, denn dies war schon das zweite unglückliche Kind, das in der Straße von der Hebamme gebracht war, und trotzdem sie alle Aschen, Wasser, Brandmale anwenden ließ, hegte sie ein Mißtrauen gegen sich selbst; ob sie irgend etwas in der Schwangerschaft oder vorher versehen hätte, ob sie sich vielleicht zu wenig aus einem zweiten Kind gemacht hätte, oder was sonst. Sie beobachtete unausgesetzt das Kind. Von dem älteren wollte sie kaum etwas wissen; sie meinte mißgünstig, daß er gerade Beine hatte; und damit sei es ja gut. Sie bekam Zänkereien mit ihren Nachbarinnen, weil sie glaubte, daß man sich über das Großväterchen mokierte; es kam zu Streitigkeiten, weil Frau Ching schließlich fremde Kinder prügelte, die von dem Kleinen beim Spiel gebissen oder gekratzt wurden. Denn das liebte das Großväterchen sehr.
In der ersten Zeit, als das Kind zwei Jahre etwa alt war, versteckte sie es in der Wohnung; sie hatte eine grenzenlose Liebe zu dem Wesen, bettelte es in der stillen Wohnstube an, es möchte doch vernünftig sein, versuchte auf eigene Faust absurde Heil- und Zauberpraktiken; das waren schöne Wochen, wenn sie etwas Neues bei dem Kind anwandte und nun von Tag zu Tag hoffnungsfreudig ihre Beobachtungen machte, sich hier betrog, da betrog. Dann wurde sie, enttäuscht, wütend auf sich, daß sie wegen dieses Krüppels mit aller Welt sich zerwerfen mußte, ließ das Kind herumliegen. Sie schimpfte hart auf den Teufel, den man ihr aufgehalst habe.
Immer gewann ihre Besorgtheit die Oberhand. Sie brachte das Kind unter Gespielen, bewirkte durch ihr abschreckendes Auftreten, daß keiner das Großväterchen zu foppen wagte, ja, daß man Angst vor ihm hatte, sich von ihm mannigfach tyrannisieren ließ, wodurch seine Unarten sich üppig entwickelten. Es wäre beinahe dazu gekommen, daß sie sich des Kindes wegen ganz isoliert hätte, wenn die Nachbarinnen nicht einsichtig gewesen wären. Frau Ching nahm ein herausforderndes Wesen an; sie duldete kein Gespräch, keine Andeutung auf ihr mißratenes Kind. Sie lebte sich in eine schroffe Abwehrhaltung hinein, die nicht nur die Dinge um das Großväterchen betraf. Ihre Gesprächigkeit, derbe Laune, verschwand unwiederbringlich. Sie war eine jähzornige, wenig umgängliche Frau geworden.
Damals kam das große Gerücht von den neuen mächtigen Zauberern, die aus den Nan-kubergen nach Süden und Osten herumzogen. Die Berichte häuften sich. Ein heller Blitz fuhr in die Frau; sie lief in die Jamenhöfe, auf die Marktplätze, wo man Geschichten erzählte, sog die Nachrichten ein, trug sie mit sich nach Hause. Sie hätschelte das Großväterchen und den älteren Jungen, sprach aufgeregt mit allen Bekannten ihrer Straße; übergab den älteren Knaben, dazu ihre ganze Wirtschaft, als die Wahrhaft Schwachen sich Tschön-ting näherten, dem Besitzer des Nachbarhauses zur Pflege, sagte, daß sie auf ein paar Tage verreise, und wanderte in das Lager des Ma-noh. Es erübrigt sich, zu berichten, wie es ihr und andern draußen erging. Sie fanden nicht, was sie suchten und bemerkten schließlich, daß sie alles Erdenkliche erreicht hatten. Man erfüllte ihnen keinen Wunsch; man entzog ihnen jeden Wunsch.
Ma-nohs Haufe lagerte in dem üppigen Gelände westlich des großen Sumpfes von Ta-lou.
Schon war der fünfte Monat gekommen.
Solche Milde und Süße wehte in der sommerlichen Luft. Gegen Abend schwommen von den Blumenhängen um das Sumpfufer verwirrte Gerüche herüber, mit dem Windhauch abreißend, klangartig; eine Schar betäubter versunkener Geister flog in Phosphorfunken herüber, dunkelte über den Boden hin, suchte sich an Menschen festzuhaken. Weit voneinander ab standen prächtige Katalpabäume auf den langgestreckten Hügeln. Die dicken braunen Knorren schwellten in buschigem grünen Zweigwerk auf, so dicht und reich, als könnten die Bäume nicht genug auf einmal einatmen von dem blauen Wind, nicht breithändig genug die goldigen heißen Tropfen des Yang auffangen. Jedes der herzförmigen Blätter trug ein glänzendes Grün zur Schau, zeigte ohne Scham das engmaschige Aderwerk seiner Eingeweide. Wenn die Lüfte vom Sumpf herüberkamen, tremolierten die nackten Blättchen, schnellten an, warfen die Geisterchen platt mit der Zunge beiseite, drängten sich verliebt aneinander. Aus der schwebenden grünen Masse, dem hängenden grünen Erdboden, hingen an Stengelchen bräunliche Fäden herunter und klappten ins Gras, wie bräunliche sich windende Regenwürmer, die vom Fall erschlagen wurden und das schöne Moos befleckten. Wo die Hügel abflachten und in die Talmulden übergingen, wucherte der ornamentale Mikanthus, der mannshohe starre Halm, die zebraartig quergestreifte Staude, unbewegliches sich verjüngendes Gelb und Grün, an dem sich die Kugeln der blassen Regentropfen mit ihren Spektren aufspießten.
Auf dem fetten Boden, den man von Westen her anfing zu brechen, lagerte in Ruhe die Truppe Ma-nohs. Man erwartete die Ankunft Wang-luns, der schon die östlicher vorgerückte Schar Chus seit einer Woche erreicht hatte.
Es war am siebenten Tage des fünften Monats, daß man einen jungen schwachen Bruder herantrug, den man auf offnem Wege bewußtlos aufgefunden hatte. Das fünftägige Fasten, das er sich freiwillig aufgelegt hatte nach einer Entrückung, bekam ihm nicht. Den leichten langen Menschen, der eine Art Kutte mit Strick trug quer über beide Arme gelegt, schleppte ein baumstarker Mann im Soldatenkittel; der Mann bückte sich mit dem schweißtropfenden Kopf weit nach vorn, um den Schatten seines riesigen Strohhuts über das Gesicht des jungen Menschen zu werfen. Überall waren Hütten und Zelte wie bei einer Armee aufgeschlagen; Ma-noh ließ zwanzig Männer abwechseln, Bretter auf Segelkarren fahren hinter und vor dem Haupttroß, weil die Kälte- und Feuchtigkeitserkrankungen unter den Brüdern und Schwestern überhand nahmen. Unter den kühlen Katalpabäumen legte der Soldat, Deserteur der Provinzialtruppen, den Kranken vor ein Zelt in das trockene Moos, tropfte aus einem winzigen schwarzen Glasfläschchen eine grüne Flüssigkeit auf die borkigen Lippen des Bewußtlosen, setzte je zwei Tropfen hinter seine Ohren. Der Kranke seufzte, suchte die Tropfen hinter den Ohren abzuwischen, kaute mit den Lippen, schlug die Augen auf. Der Soldat sah ihm zu, kommandierte, er solle den Atem verhalten, jetzt langsam atmen, jetzt den Atem verhalten.
Die Sonne war untergegangen. Ma-noh lehnte, bis die graue Dämmerung heraufzog, gegen die Bretterwand seiner Hütte, zählte, rechnete, blickte durch die hohle Hand nach den Sternen, griff sich an die Brust, lag mit der Stirn am Boden: morgen war der Tag der Vollendung Cakya-munis, des Reinen, des Schwertträgers der durchdringenden Weisheit.
Als Ma sich aufgerichtet hatte und in dem warmen Moos hockte, fing er nachdenklich zu lächeln an, von der dunklen Luft eingerundet. Seine Augen zwinkerten; gelblich standen sie in den schmalen Spalten, wie junge Hunde, die aus einem halboffenen Koffer herausschnappten. Man ging mit Papierlaternen an ihm vorbei, ein vielstimmiges glückliches Singen klang aus dem Frauenlager von dem östlichen Hügel herunter. Von Zeit zu Zeit harte gleichmäßige Männerrufe. Irgendwo betete man. Der undurchdringliche, schwere, dickleibige Himmel drängte sich eng an die Erde, die ihm, wo ihn die Sonne verlassen hatte, verwandt vorkam; mit Millionen blinkender Sterne lispelte er ängstlich nach etwas Nahem, bettelte bei der Erde, die er sonst mit kaiserlichem Gleichmut um seine geschwollenen Füße laufen ließ. Es blökte ein klägliches „Wä wä“, näherte sich, umschwirrte, dumpfte gegen die Holzlatten. Aus dem Bambusdickicht schwirrten Vögel herüber, flogen dicht an Mas Zelt vorüber in die Mikanthusfelder. Ma schloß die Augen; er sah die Satyrhähne, wie sie im Sommer auf Nan-ku und durch die südlichen Gebirge flogen: türkisblaue Hörner, runde dunkle Augen in einem schwarzen Kopf; feurig schwollen Brust und Bauch; auf braunem Mantel und braunen Schwingen des kleinen Fliegers flimmerten die augenförmigen Ringe. Wie sie bellten.
Morgen wird man den Tag der Vollendung des herrlichen Cakya-muni feiern. Ma bewegte sich nicht. Hier hielt man sich an ihn, vertraute ihm. Ihr Wohl lag in seinen Händen. Er schmeckte eine Bitterkeit an seinem Gaumen und schluckte. Es wird alles rudern, schwimmen, fliegen zu den Inseln im großen Ozean, es wird alles gut geraten und ist alles gut geraten: die Boote gerichtet, die Ruder bereit, das Steuer fest eingespannt. Kuan-yin hieß die Schiffergöttin, die die Überfahrt leitete, am Bug stehend, dem Wind die Richtung weisend. Sie lasen vor ihren Zelten, die Frauen sangen, lagen alle gut im Schatten der Kuan-yin. Er der Bootsknecht, der treue Steuermann. Sein Wohl lag in ihren Händen; er suchte sich zwischen ihren Handflächen, wie er zermalmt, zerrieben, ins Gras gestreut würde. Der weise Prior von Pu-to hatte ihm einmal die Schule nicht gegeben, den Unterricht der Novizen, den er wünschte; es war ein weiser Prior; jetzt hatte er Novizen, so viel er wollte, sie gingen mit ihm, wohin er wollte, und er war schon nicht mehr stolz.
Ma-noh verbarg, über sich gebückt, sein kaltes Gesicht in den Händen. Und er verbarg sich auch, daß er sie leise, scharf haßte, in einem tuckenden unheimlichen Schmerz, den er hinter dem Brustbein spürte. „Wang-lun“, seufzte er. Ma-noh sah ihn schon wie die andern, mythisch groß. „Wang-lun, Wang-lun“, wimmerte Ma-noh; er fühlte in sich unklare Dinge regsam, Wang-lun konnte alles schlichten. Was war dies für eine grausame Reise nach Schan-tung zu der Weißen Wasserlilie, und er kam nicht, und er kam nicht zurück.
Und er kam zu spät zurück. Wohin sollte das gehen? Sie wurden alle still und klar, hoffnungsfreudig auf eine besondere Art. Nichts wurde aus ihm. Seine goldenen Buddhas, die kristallene tausendarmige Göttin fuhr man im Karren hinter ihm her als eine Speise, von der er nie aß. In der täglichen Arbeit für die Brüder gab es keine Versenkung, keine Überwindung. Die vier heiligen Stufen berührte er mit keinem Fuß mehr: nun in die Strömung eingegangen, einmal wiedergeboren, keinmal wiedergeboren, Archat, Lohan, sündenlos Würdiger, ja, der mit demselben Blick Gold und Lehm betrachtet, den Sandelbaum und die Axt, mit dem er gefällt wird. Nichts, nichts mehr von den Freudenhimmeln, wo sie auseinander weichen, die Geister des begrenzten Lichts, die Bewußtlosen, die Schmerzlosen, die Bewohner des Nichts und jene, die sind, wo es weder Denken noch Nichtdenken gibt. Mild und stumm saßen auf dem Nan-kupasse die goldenen Buddhas vor ihm, die Ohrlappen bis auf die Schultern gezogen, unter dem blauen aufgeknoteten Haar die runde Stirn mit dem dritten Auge der Erleuchtung, weite Blicke, ein aufgehelltes, verdunstendes Lächeln über den aufgeworfenen Lippen, auf den runden schlanken Schenkeln hockend, die Fußsohlen nach oben gerichtet wie die Kinder im Mutterleib. Nichts mehr von dem. Und auch nichts von Wang, von Stille, Gleichmut; er nahm nicht teil an dem wachsenden Ring der Frommen. Und nichts von anderem, anderem.
Morgen wird man den Tag der Vollendung des herrlichen Cakya-muni feiern.
Ma-noh nahm seine zitternden heißen Finger vom Gesicht, legte die Hände vor der Brust aneinander, brachte die Finger in die heilige Mudrastellung, bannte sich in der dunklen süßen Sommerluft.
Er erhob sich, schlug für seine Papierlaterne Licht, ging in die Hütten einiger Männer, denen er mit einer starren Ruhe sagte, daß morgen der Tag der Vollendung des Allerherrlichsten Buddhas wäre; sie sollten zur Feier eine Barke der Glücklichen Überfahrt bauen. Als er zum Lager der Frauen hinüber ging, bewegten sich rasch und durcheinander die bunten Laternen nach dem andern Hügel hinauf, wo die Bretterstapel der Brüder lagen, die zum Hüttenbau nicht benützt waren. Zwanzig Schritt vor dem ersten Zelt der Frauen blieb Ma-noh am Abhang stehen, schwang seine Laterne, sagte sehr leise, als drei Frauen zu ihm liefen, morgen wäre der Tag von Cakyas Vollendung; die Brüder würden eine Barke der Glücklichen Überfahrt zimmern; er bäte die Schwestern, an die hilfreiche Göttin der Überfahrt zu denken.
Am Morgen tuteten Muscheltrompeten vom Hügel der Brüder, fünf Stöße. An dünnen Tauen zogen die Männer eine lange rohgezimmerte Barke aus dem Dunkel der Katalpen hervor, schoben sie sachte, seitwärts und hinten stützend, herunter mitten zwischen die Mikanthusstauden, die das Schiff wie Wellen teilte. Eine lange Reihe von Mädchen und Frauen tauchte in den scharf scharrenden Halmen auf; voran gingen junge Weiber, auf deren ausgestreckten Armen eine riesige bunte Zeugpuppe lag. Sie drangen vor Ma-nohs Zelt.
Ma-noh stand im Freien, sehr schweigsam, im vollen priesterlichen Ornat, mit der schwefelgelben Kutte und prächtiger roter Schärpe, die schwarze vierzipflige Mütze auf dem Schädel; den Kopf gesenkt, die Hände in Mudrastellung. Die Frauen mit der Puppe knieten hin. Es bedurfte einer langen Zeit, bis er sie ansah. Sie baten, ihrer Puppe vom Geist seiner Göttin aus Bergkristall abzugeben, ihrer Göttin das Licht zu öffnen. Ma-noh schien übernächtig; er sprach matt. Er lag geraume Weile im Zelt, wo man die Puppe neben die Kuan-yin an die Erde gestellt hatte; es schien, daß er betete. Dann kamen die Frauen herein; eine hielt eine kleine Holzschale mit einem roten Saft, in dem ein Stengel schwamm. Ma nahm den Stengel, zeichnete der Puppe rote Klexe: Augen, Mund, Nasenlöcher, Ohren; nun konnte die Puppe sehen, schmecken, riechen, hören, hatte eine Seele, war eine Kuan-yin, Göttin der Barke.
Zehn Männer und zehn Frauen gingen an diesem Tage in die Nachbarschaft zu heilen, zu arbeiten, zu helfen, zu betteln. Man betete lange Stunden auf dem Mikanthusfelde in einer Reihe die Männer, in einer Reihe die Frauen; vor dem Schiff Ma-noh. Eine Handglocke klingelte, man fiel auf die Stirn; der Priester las eintönig vor; von Zeit zu Zeit fielen die Hörer ein. Als die Sonne nicht mehr senkrecht strahlte, setzten sich Männer und Weiber gemeinsam um das Schiff, an dessen Mast die bunte Göttin angelehnt stand, zum Mittagessen hin.
Auf der Riesendschunke unter dem Zeichen des kaiserlichen Drachens segelten sie früher. Zwergteufel, Schatten, harmlose Katzen mit vertauschten Seelen kletterten früher an den Strickleitern und Masten herauf, sprangen an Schiffsbord, stürzten sie, von hinten anstoßend, ins Wasser. Ertranken nicht, wurden in ein anderes sehr stilles Land geschwemmt, zimmerten sich eine Barke, an deren Mast Kuan-yin stand. Männer und Frauen lösten sich in Gruppen, saßen und lagen im Gras, unter den Bäumen. Geschichtenerzähler gingen herum, Springer und Gaukler zeigten Künste, ein paar ehemalige Kurtisanen, die an verschiedenen Teilen des Tales musizierten, taten sich zusammen, sangen, auf die Barke tretend, um die Kuan-yin ziehend Hand in Hand, das Freudenlied von dem grünen Felsen; vielstimmig tönte das süße feine Lied, oft wiederholt, über die niedrigen Hügel, von den Bäumen zurückgeworfen.
Man glättete einen aufgeworfenen Erdhaufen auf der Höhe des Frauenhügels, indem man rasch mit Brettern auf den Boden schlug, lud einen jungen Eunuchen und eine großäugige schlanke Kurtisane ein, zu tanzen. Dann trat zuerst der junge Eunuch auf den Platz, allen im Mikanthusfeld und auf dem Abhang des Männerhügels sichtbar, mit den Gliedern einer Gazelle, aus stolzen schwärmerischen Augen um sich blickend. Er trug einen gewöhnlichen losen Kittel und lockere Hosen von schwarzer Farbe; jeder wußte, daß er eine große Kleiderkiste aus Pe-king nahm, als er zu Ma-noh floh. In seinem schwarzen lockeren Anzug, den Zopf im Knoten aufgebunden und nun die leichten Arme angehoben, tanzte er.
Er ging, zappelnd im Kniegelenk, auf und ab, knixte langsam ein, bis er auf seinen Hacken saß, zog sich ruckweise hoch und schlug die Arme, mit den Handflächen nach außen, dichter und dichter über dem Kopf zusammen. Dann stand er still, drehte das Gesicht zur Seite, so daß man sein strahlendes Lächeln sah, und fing an, ein Bein vor das andere gestellt, sonderbare Bewegungen mit Rumpf und Armen auszuführen. Er beugte sich weit nach rechts, legte die Arme vor die Brust zusammen, beugte sich weit nach links, führte den Rumpf im Kreis herum; löste nun, den Rumpf festgestellt, die Arme, ließ sie seitlich flattern, ringeln, haschen. Er schwang die Arme scharf herum, und wieder flatterten sie sanft, ringelten, haschten. Nun stellte sich rasch ein kleiner Fuß vor den andern, trippelte auf der Stelle, dabei flogen die Arme nach einer Seite und bis in die gestreckten Finger hinein folgte die Bewegung; es sah aus, als wäre der Körper gebannt und suchte vergeblich, den Händen, Fingern nachzulaufen. Die Bewegung der Füßchen wurde immer wilder, zuckend, springend, bis es dem Tänzer gelang, sich in einem großen Satz nach rechts, in einem großen Satz nach links vom Fleck zu lösen, und bis er in glücklicher Raserei hoch und nieder hüpfte, seitlich ganz auf den Boden umsinkend, und sich in einem Tremolieren wieder zurückzwang auf den Fleck. Schon glitt die großäugige Kurtisane neben ihn, die niedrige runde Stirn frei, die schwarzen Haare im Chignon der dreizehn Windungen aufgebunden, ein fettes wohlmodelliertes Gesicht; ein hemdartiger langer Kittel von hellgrauer Farbe über der kleinen Figur; aus den violetten Beinkleidern quollen an den Knöcheln weiße Spitzen hervor. Den grasgrünen Gürtel hielt sie in der linken Hand. Sie fing mit kurzen Kopfbewegungen nach beiden Seiten an, dann kam ein Nicken, Heben, behaglich langsames Kreiseln des Kopfes. Als das Rucken wieder losging, traten die Hände in Tätigkeit, die schlaff an angepreßten Armen hingen, sie klappten vor den violetten Beinen erst unmerklich, dann heftiger auf und ab, rissen die Unterarme hoch. Beide Arme ausgestreckt; unter wirbelnden Handdrehungen zuckte sie schroff seitlich mit den Hüften; und die Bewegung übertrug sich abwärts in die Beine. Erst wurden sie von dem Hüftenschwung mitgezogen, dann schwangen sie, angesteckt, gereizt, enthusiasmiert, mit ihrer Zuckung mit, nach rechts, nach links und traten, schlenkerten, zitterten in eigener Weise. Die starken Oberschenkel preßten sich zusammen; die Unterschenkel rührten sich umeinander, schnellten in den Knien auseinander, klappten zusammen. So sprang das Mädchen, den Gürtel auf beiden Armen balancierend, um den abgegrenzten Platz und den jungen Eunuchen herum, der sie in einem unübersehbaren Rhythmus mit Kopf- und Handbewegungen begleitete. Sie tanzten beide umeinander, nebeneinander. Der Eunuch sank auf die Erde und schob, die Arme im Rhythmus hochgeschleudert, langsam und gewaltsam seinen zarten Körper aus dem Boden auf; die Kurtisane stand steif über ihm, die Arme quer vor die Stirn gelegt. Als er zum letzten Wurf die Arme schwang, stürzte sie auf ihre Fersen nieder, und nun lockte er, mit den gespreizten Fingern ihren begegnend von oben, sie hoch. Als wenn sie Fische wären, schwammen sie mit ausgebreiteten Armen, geraden Fingern gegeneinander.
Sie tanzten vor den unersättlichen Zuschauern in den Maskenkostümen des jungen Eunuchen den Tanz der Pfauenfedern, der roten und schwarzen Bandstreifen. Man unterschied nicht Mann und Frau. Mit Anbruch des Abends belebten sich alle. Die Barke mußte mit der scheidenden Sonne ihre Fahrt antreten. Die Frauen hockten beratend zusammen; sie hatten lange bunte Papierstreifen über ihren Knien; sie kritzelten ihre Namen und die geliebter Seelen darauf; malten Bannformeln gegen Gespenster, Krankheiten, liefen nach der Barke und warfen die Zettel vor die Puppe. Die Barke hatten Männer am späten Nachmittag prächtig mit rotem Papier geschmückt, lange Wimpel an den Mast gesetzt, kleine Segel an Schnüre gezogen, sie mit tausend roten Augen besetzt. In dichtem Haufen umstanden alle das Schiff; die Handglocke klingelte. Jetzt blitzte Feuer auf, brennende Papierstreifen flogen auf die Planken, über Deck. Man wich zurück. Das Schiff fing an Steuer und Bug Feuer; eine hellrote Flamme huschte über Segelleinen, fraß Segel, und im Nu brannte die ganze Takelung unter blendendem Licht auf. Ein „Ahi“ des Entzückens; sie hoben die Hände. Das Licht erlosch. Die Göttin stand; die Bodenbretter, auch das Seitenholz brannte qualmend, knackend, Funken spritzend. Man warf sich hin, unablässig ängstlich betend, daß die Göttin die Wünsche auf ihre Reise mitnehmen möchte. Der Qualm wurde dichter, das Krachen des Holzes lauter; die Flamme arbeitete tüchtig. Ein weißlicher Schein, der an Helligkeit rasch zunahm, manchmal verschwand, um zaghaft wieder aufzutauchen, durchbrach den Qualm. Schon stand der Mast und die Göttin im Rauch; man erkannte noch etwas Stilles, Braunschwarzes. Breiter und höher wuchsen die Flammen; wühlten wolkenartig ineinander. Sie traten wie dünner Sand zwischen den Fugen der seitlichen Bretter heraus, griffen mit tropfenden Händen nach den schön geschnittenen Rudern, rührten sie als muskulöse Bootsleute. Prächtiger als rotes Papier wehten die feurigen Wimpel. Dann verlor der Schein alles Rötliche; ein weißes gleichmäßiges Licht blendete und nun —. Alle fuhren zurück. Zischen, bläuliches Dampfen mitten in dem weißen Meer; lange bewegungslose Rauchlinie über den Gluten.
Als das Geheul der Flammen nachließ, war Kuan-yin verschwunden. Durch den schweren Rauch drangen sie von allen Seiten an die Barke. Es verbrannte die Oberschale mit den Zetteln; sie stocherten glücklich, vergeblich nach Papier auf dem glimmenden Holz; die Göttin hatte eine freudenreiche Überfahrt angetreten. Mit leisem Plaudern ging man auseinander.
Die Nacht kam. Auf den Hügeln, unter den Katalpen, im Moos, im Mikanthusfelde schlief man. Durch die unregelmäßigen Zeltreihen kletterte vorsichtig ein aufgeschossener Mann im Dunkeln ohne Laterne, rutschte ein Stück des Hügels herunter, stolzierte im Tal: dies war der Nachtwächter der Truppe. Er ging in der völligen Finsternis, spähte rechts, spähte links; trug ein kleines Köfferchen an der Hand. Er nannte sich der „Dämmerungsmensch“; seinen wirklichen Sippennamen wußte man nicht; sehr geachtet in der Truppe war dieser ältere Mann, der ein paar Li hinter Tschön-ting sich dem Zuge angeschlossen hatte. Es gab Tage, wo er sehr erregt war, brüllte, der Karawane mit einem kleinen Metallspiegel in der Hand nachlief, sie wie ein Hund bekläffte, Zurückbleibende verdrängte, warnte, schreiend auf seinen Spiegel wies. Unter dem Kittel hing an seinem Hals ein Schwert, geflochten aus Pferdehaaren, lang und dünn, von einem Stück Holz gehalten, mit kleinen Haarzöpfchen besetzt; dem Schwert sollte große Gewalt innewohnen. In dem Köfferchen trug er den „König der linken Seite“: dies war ein Schatten von ihm, den ihm einmal ein niederträchtiger Betrüger entwendet hatte. Der Dämmerungsmensch stellte den Schatten eines späten Nachmittags, als er ihn gerade wieder foppte, sperrte ihn in das Köfferchen ein, das er mit Vorbedacht bei sich trug. Er öffnete den Koffer nie; wenn der König der linken Seite entwischte, war sein triumphierender Besitzer nicht mehr des Lebens sicher.
Abends schlief der Mann nur wenige Stunden. Er suchte nachts einen Schatten von sich, der Hai-ling-tai hieß und nur in dickster Finsternis unter besonderen Vorkehrungen sichtbar wurde.
Der Dämmerungsmensch ging auf den Zehen um die verbrannte Barke zwischen den Stauden, bog sachte Halm um Halm beiseite, kauerte mit angespannter Aufmerksamkeit hin. Ab und zu nickte ein breiter Halm, dann griff er ihn beim Fuß, betastete ihn mißtrauisch, lauerte. Als die Nacht vorrückte hörte er unmittelbar hinter sich ein Rufen: „Dämmerungsmensch, Dämmerungsmensch! “ Er blieb angewurzelt stehen, tastete nach seinem Zopfschwert. Nach einem Schweigen murrte es wieder: „Dämmerungsmensch! “ Er erhob sich, steppte, den Kopf zwischen die Schultern eingezogen, dem Ruf nach; Hai-ling-tai wollte mit ihm unterhandeln.
Glitt auf einen schmalen Gang zwischen zwei Hüttenreihen. Da blinkte auf einem Stocke eine unbedeckte Laterne; ein kleiner Mann stand auf dem Gang, rief: „Dämmerungsmensch“. Es war Ma-noh, gegen den der alte Wahrsager anlief. Ma-noh flüsterte, er möchte diese Nacht vor seiner Hütte wachen. Sobald der Morgen anbräche, möchte er hereinkommen; der Dämmerungsmensch sollte einen kleinen Auftrag für Ma-noh ausführen.
Während draußen das Umsichspähen, Schlagen durch die Luft wieder anfing, vollzog sich drin das Ereignis, das das Schicksal der Schlafenden auf den beiden Hügeln und dem Tale entschied.
Als der Dämmerungsmensch einen grauen Schimmer am Himmel entdeckte, marschierte er steif in die Hütte, wo Ma-noh auf einem Strohsack lag und sich aufrichtete. Er umarmte den Alten und hielt sich an seiner Brust fest. Der lächelte drohend über dem gebückten Schädel, schwang abschreckend sein Schwert nach den acht Himmelsrichtungen. Der kleine Priester brummte: „Dämmerungsmensch, du wirst deinen Bruder erfreuen. Geh in alle Hütten und Zelte der Männer, weck sie einzeln. Ma-noh läßt sie bitten, auf dem freien Platz, wo wir den vollendeten Buddha feierten, sich zu versammeln. Sie möchten gleich kommen. Noch bevor die Sonne aufgeht, läßt sie der arme Bruder bitten. “
Von dem Hügel krochen sie herunter. Gewimmel von Laternen zwischen kohlschwarzen Stämmen. Klappern, halblautes Sprechen, Gähnen, lahme Knochen, Drängen, Trappeln. Als sie auf dem freien Platz im Tal standen, schlug und krachte es hölzern; die Reste der Barke stürzten, von den schiebenden Menschen angerührt. Der halbverkohlte Mast sauste seitwärts, die Splitter flogen, rissen Löcher in Laternen. Die Männer stapelten die Bretter, hockten herum, warteten.
Ma-noh kam im zerrissenen bunten Mantel. Hinter ihm stolzierte der feierliche Dämmerungsmensch; er schwenkte auf dem Arm Ma-nohs Priestermantel, Schärpe und Mütze. Als man Ma einen erhöhten Platz auf dem Bretterstapel einräumte, legte sein Begleiter die Kleider neben ihn, nachdem er in die acht Himmelsrichtungen mit dem Zeigefinger gestochen hatte. Gequollen und rot waren Mas Augen; sein farbloses Gesicht gedunsen vom Weinen; auf Händen und Unterarmen blutige Kratzstriemen.
Die vielen Männer und ihr Führer, der unüberwindliche Zauberer, saßen sich stumm gegenüber, Mauer gegen Mauer. Die Nächstsitzenden blickten auf Ma-nohs Schärpe. Ihre Unruhe übertrug sich auf die Entfernteren. Man weckte ihn, rief ihn an. Er solle sprechen.
Er stand auf, drehte die Priestermütze in den Händen. Er erzählte stockend, daß er auf dem Nan-kupaß jahrelang den goldenen Buddhas vergeblich gedient hätte. Der Mann aus Han-kung-tsun kam da, er lebte nun richtig. Aber Wang-lun sei jetzt monatelang weg, er käme nicht zurück, er käme nicht zurück und wenn Wang-lun jetzt zurückkäme, so käme er zu spät. Dies wolle er ihnen sagen.
Ma-noh fiel in sich zurück. Wenn er die Lider raffte, blickte er erschöpft, aus übergroßen einschlafenden Augenkreisen. Seine Stimme klang völlig verändert, weich, nahe, wie die eines Wohlbekannten.
„Was ist geschehen? Hat dich einer verletzt? Was hat man dir getan? “
Er wiederholte dreimal, fünfmal, zehnmal, daß er zu ihnen sprechen wolle, verschluckte sich, verschränkte die Arme, wandte sich von einer Laterne ab, die man ihm ins Gesicht hielt, flüsterte: „Omito-fo, Omito-fo, Omito-fo. “ Und dann rief er laut mit der Stimme, die ins Herz schnitt: „Ich will fort. Von ihr, die über das schaumvolle weiße Meer führt, ist mir nichts zuteil. In den wachsenden Ring der Frommen bin ich nicht aufgenommen. Ich muß mich opfern für euch, ich weiß, daß ich es muß, weil mir anderes versagt wurde. Aber euer armer Bruder, der nicht euer Bruder ist, kann nicht mehr leben. Ich will fort. Schmäht mich nicht oder schmäht mich. Euer armer Bruder ist rettungslos auf das Rad des Daseins geflochten und weint darum vor euch. “
Die Männer beteten. Die klaren Köpfe wurden von einer stärkeren Bestürzung befallen.
„Was willst du? “
„Du brauchst uns nicht mehr zu führen. Wir wollen uns abwechseln. “
„Hab doch Geduld, Ma-noh. Wang-lun steht nur zweihundert Li hinter uns. “
„Ma, dich hat ein Dämon befallen. Glaub es mir. Das ist ein Dämon. “
„Du bist unser Bruder. Wir sind nicht reiner als du. Du mußt verzweifeln. Bleibe hier, bleibe bei uns, Ma! “
„Was willst du? “
Mas Erregung wuchs. Die Zurufe erreichten ihn nicht.
„Ich will fort. Ich bin an das Rad des Daseins geflochten. Es will mich schleppen durch alle unreinen Tiere und Kräuter. Ich widerstrebe nicht, nein, ich widerstrebe nicht, nicht mehr. Ich habe widerstrebt dem Schicksal bis zu diesem Augenblick, wo ich den Dämmerungsmenschen im Mikanthus nach dem Hai-ling-tai suchen hörte. Meinen Schatten hat man mir gestohlen. Ich war nicht so schlau wie der Dämmerungsmensch. Ich habe kein so gutes Schwert wie er. Ich habe keinen Koffer wie er. Ich bin nicht so wachsam wie er. Mein Schatten ist nicht der König der linken Seite, ich habe auch den Hai-ling-tai verloren, und den Lu-fu und den Soh-kwan und den Tsao-yao. Wer alle Schatten verloren hat, muß sie suchen oder muß sterben. Verzeiht mir, Brüder, daß ich nicht mehr widerstreben kann, daß ich mein Schicksal über mich ergehen lasse. Nicht mit Stillschweigen, denn das kann ich nicht, sondern mit Greinen, Heulen, Zerfleischen meines Lebens. Ich muß in das Licht gehen, das mich beleuchtet. Verzeiht mir, Brüder. “
Die Männer saßen dumpf da. Ma schlug mit Keulen auf sie. Die Köpfe der meisten senkten sich, sie hielten den Atem an.
„Ich habe euch rufen lassen, bevor es hell wird, denn ich will mit mir noch an diesem Tag der Vollendung des herrlichen Cakyasohnes fertig werden. Nicht vollenden will ich mich, nur beenden. Euer armer Bruder glaubt nicht mehr an eine Vollendung für sich. Er hat der hundertarmigen Frau keinen Zettel mit seinem Namen in die Barke geworfen, denn er weiß schon lange, daß sie ihn nicht mitnimmt. Seht mich, einen Menschen, der seufzt und stöhnt, und so in — die Freiheit geht. “
Er verzog seinen geschwollenen Mund, so daß er zu lächeln schien. Er bückte sich, suchte mit den Händen auf den Brettern, zog seine gelbe Kutte empor, wiegte sie über den Armen. Ma-noh war besessen von Schmerz. „Ich wäre glücklich, wenn ich Wang-lun nicht gesehen hätte. O hätte ich Wang-lun nicht gesehen, meine gelbe seidene Blüte! In meiner Hütte auf Nan-ku hab ich mich angespieen, hier muß ich meine Eingeweide zerreißen. “
Nahm einem Manne neben sich die Laterne aus der Hand, leuchtete vor sich, über sich, streckte sich vor, horchte über die schwarze lautlose Masse hin. Kraniche flogen vom Sumpf herüber. Dann schwang er mit beiden Armen die Kutte wie ein Banner herum und rauschte: „Wißt ihr, wohin er geht, Ma-noh, der Priester der Kuan-yin auf Pu-to-schan, der Freund des Wu-wei, der Lehrer der kostbaren Regeln? Wohin er stürzt? Ich sage es euch gern, was ich schon seit Wochen gewußt habe, als mich Wang-lun hat gehen lassen mit euch. Als er mir den Kessel und die Bohnen gab und nicht mehr Zeit fand zu sagen, wie ich kochen sollte. Er hat mich verlassen. Er darf nicht böse Geister auf mich hetzen, wenn ich ihn verlasse. Yen-lo-wang, der Fürst der Unterwelt, weiß, wie bitter mir schmeckt Wang zu verlassen. Wißt ihr, in welche Freiheit Ma-noh geht? Dämmerungsmensch, weißt du es nicht? Sui, Twan, Chang, keiner von euch? “
Jetzt lachte er hitzig, leicht wie eine Seifenblase platzend, trällernd mit dem weichen Tonfall, den er an diesem Tage zum erstenmal fand: „Ich gehe — — zu einer Frau auf dem andern Hügel, die mich vielleicht schon erwartet, liebe Brüder. Nun wißt ihr’s. Und nun ist alles aus. “
Ein Schluchzen und Brüllen von der furchtbaren Art des Weinens älterer Menschen klang eruptiv aus der dunklen Masse. Niemand regte sich, hob den Kopf. Der kleine Priester tappte die Bretter herunter. An der vorderen Reihe der Hockenden ging er vorüber, keiner sah ihn an. Am hinteren Ende der Barke, wo das umgebrochene Steuer lag, zupfte ihn einer am Mantel. Ma blieb stehen. Aus dem Dunkel wackelte ein riesiger Mensch auf, sagte herunter mit harter Stimme: „Bruder, du mußt an den nächsten Ast. “
Ma riß verächtlich seinen Rock los. Zehn Hände griffen nach dem Riesen, der mit kalter Stimme dröhnte: „Er will uns verraten. Keine Regel hat hier Geltung. Er muß an den nächsten Baum, Brüder. “
Zwei Männer verstellten ihm den Weg, kaltblütige Bauern, die eine Woche bei der Truppe waren. Sie schleuderten seine Hand ab: „Du bist kein Richter. Wir sind Brüder zueinander. Wenn du Ma angreifst, werden wir dir die Hände abschlagen. “
Indem sie der Riese noch fixierte, packten sie ihn bei den Beinen, kenterten ihn auf die Erde, stemmten ihn nieder. Er heulte, klammerte sich an die Hosen der Bauern. Fackeln, Holzstücke flogen von hinten über sie. Man drängte sich um die Ringenden, sperrte sie auseinander. Sie keuchten.
Das entsetzliche Weinen krampfte aus der schwarzen Masse.
„Wo ist Wang-lun? Warum kommt Wang-lun nicht zu uns? “
„Ich will beten, liebe Brüder,“ sang jemand laut, „unser Ring wird sich zusammenschließen. Die Zeit des Maitreya ist noch nicht da. Ich muß beten. Wir sind verloren. “
Die Männer krümmten ihre Wirbelsäulen, rieben ihre Schläfen an dem feuchten Moos. Die bittende Sutra der Überwindung schauerte aus tausend Mündern über das graue Feld.
Ein junger Mensch, der Ziseleur Hi, gewöhnliche Gesichtszüge, breiter vorgeschobener Unterkiefer, sprang langbeinig durch die Reihen, stieg ungeschickt über die Rücken einiger Männer, pflanzte sich auf dem Bretterstapel auf, kreischte in Ekstase, mit den Händen fuchtelnd: „Es hilft uns nur das Beten. Maitreya kommt. So muß die Stunde, der Ort beschaffen sein, wenn Maitreya kommen soll. Beten, um aller fünf Kostbarkeiten willen, beten. Bleibt nicht liegen. Schließt den Ring. Ihr seid meine Brüder. Steht mir bei! “
Er grimassierte fort, warf die Arme wie Mühlräder umeinander, wälzte sich schäumend auf den Brettern, von denen er bei einer Streckung herunterpolterte.
Das dumpfe Weinen in der Masse vertiefte sich zum Stöhnen, zum hilflosen, stoßweisen Ächzen. Die Hälse reckten sich weit vor nach dem krampfenden Ziseleur. Die Augen rollten, je länger sie hinaussahen; das Feld und der graue Hügel verschwamm. Ihr Mund klaffte. Sie lächelten alle seltsam und machten Gesichter, als ob sie neugierig gespannt wären. Der Speichel tropfte ihnen über die Unterkiefer, sie schnüffelten, sie stimmten ohne es zu merken in das Gröhlen zur Rechten und Linken ein. Dann wollten sie noch einmal rasch Hi etwas fragen. Aber beim Aufrichten befiel ihre Unterarme, Knie und Nacken ein Zittern. Ein Schütteln, Schleudern der Glieder, Starre, Rückwärtsbeugung der Nacken, ihr Lächeln wurde stärker. Schon zuckte es wohlig über die Schenkel, die Bauchwand, in den Flanken, warf sie herum.
Die rote Welle schlug über das Tal.
Der Dämmerungsmensch und zehn andere wanderten her und hin durch das Feld mit Binsenruten, dornigen Zweigen. Sie sprangen den Befallenen auf die Brüste, strichen ihre Hände und Münder, fächelten die gefährliche Luft von ihnen weg, stachen ihnen mit den Dornen unter die Brustwarzen, über die Scheitel, plappernd, sich wehrend, wendend, anspringend.
Der kleine gebückte Mann am zerbrochenen Steuer der Barke drehte den Kopf nach allen Seiten, blickte lange Zeit den und den an. Er dachte nicht. Er strahlte. Warum sie nur alle hinfielen, wie gewandt dieser da sprang. Man müßte Nadeln glühend machen und ihnen unter die Fußnägel stecken, damit sie erwachen. Als er neben sich das Schluchzen hörte, hob sich sein Brustkorb, wie ein Berg unter einem Erdbeben, seine Kehle wurde heiß, eine glatte Hand strich an seiner Speiseröhre wie an einer Wurst auf und ab, verschob eine Walze; er weinte mit ihnen. Leise und glucksend, bemüht nicht aufzuhören, immer fließen zu lassen diesen unbekannten warmen Quell, der über seine Lippen, Fingerspitzen, Nägel rieselte, mit dem er sich Schläfen und Ohren betupfte, die Hände wusch und wusch.
Das steinerne Brüllen im Tal verlor sich. Überall riefen sie sich heiser an, schoben sich voneinander. Sie hatten sich quer übereinander gewälzt. Einer richtete sich auf und rieb seine gequetschten Schienbeine. Einer saß und betrachtete, als ob es Edelsteine wären, die verkohlten Holzstücke unter seinen Knien, prüfte einen Splitter an der Lippe, leckte mit der Zungenspitze. Sie scheuerten sich den Speichel vom Kinn mit langsamen, unterbrochenen Bewegungen, gähnten, rülpsten, spien aus. Die stumpfen Körper brüteten nebeneinander, zogen finstere Stirnen. Plötzlich, wie angeweht, zielten sie mit den Augen aufeinander, erkannten sich, buckelten sich hoch.
Sie schnurrten, fragten hastig: „Ma-noh will fort. Da am Steuer sitzt er und weint. “ Einige wollten sich vor ihn hinwerfen, er solle bleiben, verzweifelt. Aber das waren nur kurze Zuckungen, Muskelphantasien.
Die Masse hielt wieder erschreckend an sich, in großer drängender Erwartung. Jede Handbewegung, jedes beobachtende Schielen, jedes Räuspern konnte die Wage zum Ausschlag bringen. Mehrere ertrugen die Spannung nicht; noch schwach von der vorangegangenen Erregung suchten sie die Last irgendwie von sich abzuwälzen. Es war das Beste, das Fong-schui zu befragen, Konstellation von Tag, Stunde, Ort, Wind, Wasser, Bodenschwingung zu bestimmen, aus dem Werfen der kleinen Holzstäbe Klarheit zu gewinnen. Ein Mann suchte aus seinem Gürtel nach den Stäben inmitten der stummen Masse; andere sahen es, standen gleichzeitig auf, wollten sich absondern. Andere mißverstanden dies Aufstehen und Gehen, als ob die Zukunftsbefrager sich für Ma-noh erklärt hätten und sich zu ihm setzen wollten. Sie schlossen sich ihnen an. Man hielt sie unsicher fest, man rief: „Beraten, sprechen! Sagt, was ihr wollt! Sprechen! “
Der kleine Nan-kupriester merkte erst halb was vorging. Er hatte gezweifelt, ob man ihn nicht schmähen und schlagen würde. Daß man aber nicht daran dachte, von ihm zu lassen, von ihm, dem kleinen mißratenen eingeständlichen Tier, von ihm, der die Weihen von sich warf und zugab, rettungslos in den Kreis der Wiedergeburten gebannt zu sein, dies konnte nicht bald an ihn heran. Und als es herankam, schmetterte es über ihn. Es sprengte seine Brust mit Ellenbogen von innen, schwoll von den Eingeweiden über das Herz, das still stand, in tollem Takt wuchtete, Glocken dröhnte, Gericht posaunte, breitete sich über die Arme und Kehle aus, und wie es um die Mundwinkel laufen wollte, nickte sein Kopf und baumelte vor der Brust. Er war ohnmächtig geworden, kam langsam, die Ohren voll Hymnen, zu sich, hing an dem Dämmerungsmenschen. Er strahlte. Das warme Wasser quoll ihm wieder über das Gesicht.
Er ließ den Alten los, kletterte auf den Bretterstapel: „Brüder, sind wir frei? “ So stammelte er, schluckte an den Tränen. „Ich habe mich bis zu diesem Tag mit einem Stein geschleppt, mit einem bösen widerspenstigen Geist, der mich bestahl. Ich bete zur Kuan-yin, die mich nicht erhört hat, ich rufe zum Maitreya, der auf mich hören wird; ich will arm bleiben, klein, ein Wahrhaft Schwacher, der das Schicksal nicht beugt; ich will keine Dämonen in mir nähren und Opfer der Werwölfe sein. Ich will ein armer Sohn der armen achtzehn Provinzen bleiben. Ihr schmäht mich nicht; ach, ihr schmäht mich nicht; ihr seid gut. Ich weiß nicht, was ich spreche. Ich kenne mich nicht vor Dunkelheit. Wer die Seele frei hat, kann das Westliche Paradies finden. Ich habe mich nicht in Gelüste geworfen; ich habe mich gereinigt für einen Freudenhimmel; ich habe meine eingesperrten Seelen auf den Pfad des höchsten Kaisers gezwungen und will sie gehen lehren und mit ihnen laufen. Und die Zauberschlüssel finden zum Kun-lun. Mit euch, meine Brüder. “
Er jauchzte noch viel in dieser Weise. Das morgenliche Feld war ganz leer. Ein Knäuel von Männern umgab ihn, umschlang ihn, küßte seine Füße, fetzte seinen Mantel herunter.
Über die östlichen schwarzen Wolken fuhren blendende Streifen. Das allgemeine rauchartige Grau lichtete sich schnell. Es wurde von innen aufgeworfen, gesprengt und weggeblasen. Die blühende Landschaft weitete sich. Es blitzte von kleinen Weihern auf. Im Südosten, am Sumpfe von Ta-lou, stand schon ein magerer fadendünner Schein; jetzt bohrte sich die Sonne ein Loch, ein Rohr, einen Trichter, und von da prallten die langen Strahlen her, unter denen sich das Grün der Gräser und Bäume heftiger und heftiger entzündete.
Die Blicke der jüngeren Männer flimmerten auf den Halmen, auf dem Frauenhügel. „Unsere Schwestern, unsere Schwestern“, sagten sie, sahen sich zweifelvoll, mit schwindligen Knien an; viele umschlangen sich zitternd, blieben stehen, beruhigten einander, als wenn ein Unglück geschehen sollte.
Ein gigantischer Dorfschullehrer streichelte den knabenhaften Menschen, der an seinen Ärmeln nestelte. „Tsi, die Pfirsichblüte“, flüsterte der Lehrer, „wirst du suchen. “
„Tsi —, ich will sie nicht suchen, ich will nicht. O was geschieht uns. “
Einige lagerten ihre Leiber ins Gras; sie warfen sich auf das Gesicht, kauten an den Halmen; Mienen gefährlich; sie schlugen sich mit aufgedeckten Erinnerungen herum; warteten geduldlos auf das Stürmende, das sie wieder zu Sinnen brächte.
Auf die Höhe des Männerhügels waren manche gestiegen und kollerten nebeneinander unter den grünen Wolken der Katalpabäume; lächelten, beteten, träumten; ließen keinen Blick von dem Frauenhügel. Reichtum aufgehäuft! Eine Welle schlug herüber an Brüste, gegen Hüften.
Von ihnen standen welche auf, als es auf dem Frauenhügel leise klingelte. Sie sprachen nichts zueinander, einer folgte dem andern, indem sie sich oft umblickten nach den übrigen. Sie erreichten in halbem Laufe den Fuß des Hügels. Im hohen Gras schwarze Klumpen, mit Kleidern, Köpfen, Knien, wälzten sich stöhnend, rissen, schlossen die Augen. Sie liefen mit der Sicherheit von Waldtieren. Ihre Blicke reizten. Sie riefen die Klumpen bei Namen, zeigten ihre verheißenden Gesichter; sie lächelten, daß den andern das heiße klopfende Blut in Schläfen, Augen, Füße schoß.
Der Ziseleur Hi lief den andern voraus auf einem Weg, der um einen Weiher führte und die Lagerstraße vermied. Nicht weit vom Fuß des Frauenhügels ballten sie sich zusammen. Hi rief: „Was wollen wir tun? Wir wollen sie täuschen, Brüder. Wir beten mit ihnen zusammen. “
„Schickt einen zu ihnen, sie möchten sich versammeln. “
Man hörte, wie einer rief: „Dies ist fürchterlich“, einer drängte sich durch die übrigen, es war der junge Mensch, er lief davon. Hi gurrte: „Ich will sie rufen, kommt hinter mir. “ Während er vorüber zackte, wallten die Brüder demütig, Arme verschränkt, gesenkte Köpfe, bezopfte Kugel bei Kugel, den Hügel hinauf; das scharfe Zirpen der Grillen begleitete ihr Gemurmel: „Omito-fo, Omito-fo! “
Sie standen auf dem Frauenhügel unter dem schweren Laubwerk. Unter dem Laubwerk wimmelte jene Masse, bei deren Anblick sich die Herzen der Brüder tiefer und langsamer zusammenkrampften und die so volle Pulse durch sie trieb, daß langsam der weiche Waldboden unter den Füßen mitschwang, jede Welle rollend weitertrug. Da blickten mit neugierigen und verwunderten Augen entwichene Ehefrauen den Brüdern entgegen; sie schienen noch immer bedrückt, daß ihnen die Luft so ungehindert ins Gesicht schlug und jeder ihren Mund sah. Zwischen blinden Bettlerinnen, Marktweibern schoben sich graziös die galanten Mädchen, die hellen Tupfen auf dem strahlenden Blumenfeld, die Glückbringerinnen, Hoa-kueis; ihr Ernst ohnegleichen; um ihr sanftes Wesen schwebte der Hauch des Pavillons der Hundert Düfte. Im Moos bogen verschüchterte Töchter angesehener Familien ihre behüteten kleinen Körper; sie nestelten an ihren Rosenkränzen, hauchten ihre Andacht, als wenn es sich um eine furchtbedrohte Schulaufgabe aus dem San-tse-king handele.
Unterhalb der laubdunkeln Hügel ging Ma-noh durch die Lagergasse. Eine breite Hand schob mit einer abweisenden Geste die grauen Dämmermassen am Himmel beiseite. Feierlich zogen die weißen Schwäne des Lichts am Himmel.
Wie da der Frauenhügel zu zittern anfing.
Ein tausendfältiges Schreien und Kreischen sich über das Tal schwang und vom andern Hügel zurückgeworfen wurde.
Wie das Entsetzen verzehnfacht sich wiederholte, ein tiefes Grollen, Knacken, Brüllen sich unter die scharfen Stimmen mischte.
Ein augensperrendes Grausen aus dem Katalpaschatten zu entwischen versuchte und zurückgerissen wurde.
Wie nach dem minutenlangen Rasen weiße und bunte Kleider auf dem Hügelkamm vorspritzten, niederfielen, in das Moos tauchten, ohne Laut herunterrollten.
Auf dem Hügel eine sonderbare Stille eintrat, unterbrochen von langen, sakkadierten Schreien, katzenhaft durchdringendem Winseln, Musik zu atemloser Ohnmacht, die sich in die Finger beißt, die Seelen wie in Essig einschrumpfen läßt, zur Besessenheit der Verzweiflung, die Körper um sich wirbelt.
Dann dröhnten Männerstimmen ins Tal: „Ma-noh, Ma-noh, der Drachen fliegt! Ma-noh, unsere Schwestern! “
Unten brandete es über die schmale Lagergasse; man horchte hinauf, sah einander an; man stopfte sich die Ohren, trommelte die Brüste. Über Ma-noh schmetterte es zusammen. Es schien ihm, wie man um ihn raste, länger als einen Augenblick, daß er ein Fürst der Unterwelt wäre, mit hundert Armen, Geißeln, Schlangen, und hetzte fiebrige Seelen zwischen die Wandungen der Eishölle, immer in das fressende Scheidewasser hinein, von den glasglatten Wandungen herunter; sie knarrten und grinsten, er barst vor Freude, schwenkte die Schädelschale. Blutgerinnend drang es auf ihn ein. Schon pinselte eine Schwäche die ganze Innenwand seines Kopfes. Im halben Sinken fühlte er, was vorging, ächzte, stemmte sich hoch, balancierte die Last.
Er blickte mit einer kalten Glut um sich. Besinnung, Ruck, mit dem ein gleißendes Machtgefühl aus ihm heraussprang, um sich schlug, kalt äugte.
„Es ist gewollt. Dieses nehme ich auf mich. “
Zwei tiefe Atemzüge. Er drehte sich betäubt um; das Tal blühte wie vorher. Er empfand mit verstecktem Entsetzen, daß etwas Unbekanntes aus ihm hervorgetreten war und herrschte. Daß er Wang-lun überwunden hatte. Eine rauschartige Angst floß herunter durch das Mark seiner Knochen.
Zwischen den Mikanthus lag man verwirrt. Schwache Hilferufe vom Frauenhügel. Ma-noh hatte sie falsch geführt.
Mit einem leeren, meilenfernen Blick irrte Ma-noh über sie, wandte sich ab.
Sie drückten ihre Leiber an den Boden. Der Hügel knisterte sie gegen sie her.
Reglosigkeit, stundenlang, sonnenbeschienene Wildnis. Aus den Hütten des Frauenhügels stieg ungehört das entzückte Seufzen, stahl sich schwach durch die Bretter, kräuselte wie Rauch, abirrender Blick, Ausklang eines Tamtams gegen das allgemeine grüne Dach.
Als die Sonne heißer schien, bliesen im Tal die Muscheltrompeten vor Mas Hütte, fünfmal hintereinander fünf Stöße: das Zeichen zur gemeinsamen Versammlung.
Stauden schwankten, Büschel drängten sich zusammen, Rücken krümmten sich, Köpfe tauchten hervor.
Lange bewegte sich nichts auf dem Frauenhügel. Dann schimmerten weiße, bunte Tupfen zwischen den Stämmen. Rennen schattenschwarzer Männer, Vermischen der Farbenflecke, Händewürfe von Geräuschen, Sprechen, Rufe in Fetzen, Schwall von Lärm. Bunte Schwestern umarmten sich im Herabgleiten, Brüder Hüfte an Hüfte. Eine jubilierende lichtgetränkte Wolke senkte sich in das Tal.
Im Nu verstreuten sich die Schwestern, lachend, mit springenden Bewegungen, unter die Ernsten, füllten im weiten Bogen den Raum, auf dem noch die verkohlten Bretter der Barke in die Luft spießten. Ma-noh, schwefelgelb und rot, trat rasch fest in das brausende Gewimmel, das alle in sich sog.
Er verzog keine Miene, als von irgendwo angestimmt, von Frauenstimmen getragen, laut, klar und süß ein Freudenlied über das blühende Feld scholl, ein Lied, allen wohl bekannt, von den zarten Bewohnerinnen der bemalten Häuser gesungen, wenn sie einladend auf ihren geschnitzten Booten über die Teiche fuhren.
Ma-noh redete: „Es muß Friede zwischen uns sein, liebe Brüder und Schwestern. Es soll uns nichts belasten, die wir nach den goldenen Inseln segeln. Wir wollen den alten Frieden zwischen Yin und Yang schließen. Ich bin glücklich, daß ihr mich angehört habt, und will es euch nicht vergessen, wenn ich im Besitz der fünf Kostbarkeiten wäre. Wahrhaft Schwache werden wir bleiben. Wir werden dem Tao nachgehen, seine Richtung erlauschen. Bleibt unermüdlich im Gebet, so werdet ihr die große Wunderkraft erlangen, die euch nicht entgehen kann. Ihr baut nicht vergeblich hölzerne Pferde wie der Alte aus dem Staate Lu, die von metallenen Sprungfedern gestoßen wurden, Männer und Wagen zogen. Solche hölzerne Pferde werdet ihr aus euren Seelen nicht machen, aus den Seelen, die in euren Lungen, eurem spülenden Blut, euren schaukelnden weichen Eingeweiden wohnen. Ihr blast im Lande die Flöte und macht die Luft wärmer, so daß das Korn aufschießt. Ja, ihr werdet die Wolken im Nordwesten aufsteigen lassen, das Rohr blasend; Regen wird fließen, Taifune stehen. Acht Rosse sind bereit, sechzehn Stationen macht die Sonne, ihr bereist sie an einem Tage.
Bleibt arm, seid fröhlich, enthaltet euch keiner Lust, damit ihr sie nicht vermißt und so unrein und schwer werdet. Euch, meine Schwestern, sehe ich, euch, ihr Königinnen des sanften Vergnügens, ihr habt viel dazu getan, daß unsere Dinge diesen Lauf genommen haben. Habt verhindert, daß die Öffnungen unserer Herzen ins leere All münden. Ich war ein schlechter Sohn der achtzehn Provinzen, daß ich der Weisheit des fremden Cakya-muni vertraute, und seine Freudenhimmel mit eurem, mit unserem blumigen eintauschte. Wir stehen auf den Stufen zum Westlichen Paradies. Was ihr Gebrochenen Melonen uns geschenkt habt, nehmen wir an. Wir danken euch, wir danken euch. Ich nenne mich mit euch Gebrochene Melone. Und so wollen wir alle am Sumpf von Ta-lou heißen. “
Das lufterschütternde Jauchzen und Klatschen, Zubodensinken, Umschlingen. Das mauerdichte Umdrängen Ma-nohs, dessen rätselhaft gleichgültige Miene keiner sah. Aus ihm tönten die Worte, wie Stimmen eines versteckten Singvogels hinter einem umsinkenden Tempel. Eine neue Ähnlichkeit hatte sein Gesicht angenommen, mit dem Ausdruck eines fliegenden Tieres, das seine Kopfform, Augen, Federn ganz vom Wind, den es durchfährt, modellieren läßt; auf einem Ast sitzend hat es ein unbegreifliches Aussehen: weil der Wind und der Flug fehlt.
Um Mittag. Sie zerstreuten sich, die Wankelmütigen, die Ernsten, die Freudigen, die Hochgemuten, die Blinden, Schwachen, die kräftigen Männer, die leichten Tänzerinnen, die inbrünstigen Propheten.
Abends umschlossen zum ersten Male die Zelte und Bretterhütten, die sich zusammengetan hatten. Sie beteten nebeneinander, ihre Gebete verwirrten sich im Dunkeln. Es waren keine Schmetterlinge, die sich aus dem Gras erhoben, sondern zwei Fäden, die sich nach oben gerade zogen, jetzt sich verknäulten und zu keiner Weberei mehr taugen konnten. Ihre verschränkten Arme wichen schwach auseinander, sie tasteten im Finstern mit den feuchten Händen nacheinander, glitten über die elektrisch zuckenden Gesichter. Da wurde aller Stolz gebrochen, alle Unruhe hingelegt. Diejenigen, die starr und aufrecht in dem Ernst der Wahrhaft Schwachen gegangen waren, bogen sich unter dem Glück; der Sommerwind wehte als ein Banner, das aufgepflanzt war auf einer Etappe zum Kun-lun. Wie im Dunkel der Hütten unter den Katalpen die Gesichter gleichmäßig milde wurden, Geister und Leiber aufgelockert wurden von einer breiten gewaltigen Egge, die über die ganze Erde rollte und wuchtete, grub in der Nacht.
In dem Sumpf von Ta-lou wuchsen die Lotosblumen; mit grünen tellergroßen glatten Blättern deckten sie das unbewegliche Wasser, rote Blüten tauchten zwischen ihnen ein; lange Stengel, die mit dickgeäderten Blättern über die verwesenden Muscheln griffen; an jedem Stengel garnten dünne Algenfäden, die sich in der Tiefe verfilzten; grüne behaarte Köpfe hingen herunter. Unergründlich stand der Sumpf und dünstete.
Diese Nacht verging nicht ohne ein schreckliches Ereignis. Einige Männer hörten in der Stille mehrmals das heftige Schelten des Dämmerungsmenschen. Sie beachteten es nicht, da sie glaubten, daß er sich mit einem seiner Schatten schlüge. Aber er schrie unaufhörlich, und es fiel einigen, die aus den Hütten herauskamen, auf, daß der Dämmerungsmensch nicht herumging und das Rufen immer von einer einzigen Stelle des Männerhügels kam. Sie fürchteten, daß er vielleicht wirklich einen Schatten gestellt hatte; grauten sich vor dem Anblick des Kampfes. Aber endlich blickten sich fünf Männer beunruhigt an, faßten Mut, liefen durch das Feld den Hügel hinauf mit Laternen. Als sie an den Ort des Geschreis kamen, lag der Dämmerungsmensch arbeitend im Gras und unter ihm ein Mann, der sich nicht bewegte, über dessen gequollenem Gesicht der Dämmerungsmensch mit seinem Schwerte fuchtelte. Er rief den Bewegungslosen bei Namen, hielt einen Spiegel an sein Ohr. Die Männer beugten sich über den Stummen, leuchteten ihm auf die glotzenden Augäpfel. Es war jener verzagte junge Mensch, der sich an einem Baum aufgehängt hatte. Der Dämmerungsmensch war gegen die Leiche gelaufen und hatte sie abgebunden. Einer der Männer nahm einen spitzen kleinen Stein, ritzte sich die Haut seines Armes, tropfte dem jungen Menschen das heiße Blut in den krampfhaft geschlossenen Mund, dessen Kiefer zwei Männer gewaltsam sprengten. Es half nichts mehr; der Körper war steif. Er hatte Tsi, die Pfirsichblüte, nicht gesucht. An diesem Abend, als er mit ihr zurückkehrte und vor ihrer Hütte stand, hatten sich die beiden ernst angesehen; die Pupillen ihrer hochgeschwungenen Augen erweiterten sich, aber sie blieben beide ruhig und trennten sich nach einem kurzen Dastehen. Der Jüngling schien sich erst im Mikanthus verkrochen zu haben; dann schwankte er aus dem Feld auf den Männerhügel, wobei ihn der Dämmerungsmensch traf, dem er sagte, er müsse sich unter einen Baum schlafen legen. Er hängte sich aber an seinem Gürtel auf.
Den Gipfel der Kaiserherrlichkeit erreichte er nicht; er war einen anderen Weg gegangen.
Nach drei Tagen stieß Wang-lun zu ihnen.
Ma-noh war unschlüssig gewesen, ob er Wang selbst die Veränderung in seinem Haufen mitteilen sollte. Dann schickte er fünf Männer als Boten, die alles, was sie wußten, Wang-lun, der anderthalb Tagereisen entfernt stehen sollte, berichten sollten. Er ging mit einigen Erfahrenen zu Rat und horchte sie vorsichtig aus. Aber es gelang Ma-noh nicht, sie auf den Gedanken zu bringen, daß Wang die Änderung ihrer kostbaren Grundsätze ablehnen könnte. Sie waren von der Heiligkeit und Tragfähigkeit ihrer neuen Ideen rapide durchdrungen; es konnte nur die Sache einer Besprechung sein, meinten sie, Wang zu überzeugen und mit ihm auch die entfernten Haufen der Wahrhaft Schwachen zu bekehren. Von Wang, den niemand von ihnen gesehen hatte, ging ein derart starker Einfluß aus, daß sie überhaupt nicht vermochten, gegen diesen Mann zu denken. Sie würden geglaubt haben, dem Tode zu verfallen, wenn sie etwas gegen ihn unternähmen. Ma-noh sprach einiges von ihrer Führerrolle bei den Gebrochenen Melonen; sie faßten, da er unentschlossen redete, nicht, wo er hinauswollte; es gelang nicht, sie zu locken.
Wang-lun hatte der Boten nicht bedurft; vorher war ihm das Gerücht zugetragen worden. Er kam mit den Boten zusammen in Mas Lager an. Als er von Laternenträgern geführt bei Nacht in Ma-nohs Hütte trat, wollte er mit einer Handbewegung die junge Frau aus dem Raum weisen, die neben dem ehemaligen Pu-topriester auf der Matte hockte. Aber Ma griff die Schwester bei der Hand, führte sie in die Nachbarhütte, kehrte allein zurück.
Eine winzige Öllampe brannte am Boden; an der rechten Wand des kaum mannshohen Raumes raschelte auf dem Moosboden ein Strohsack; Lumpen, Tücher, Kittel daneben. An die linke Wand war der seitlich umgekippte Karren Mas geschoben; unsicher darauf balancierten, von ein paar Streiflichtern getroffen, die goldenen Buddhas; die tausendarmige Kuan-yin aus Bergkristall stemmte den Kopf gegen die Wand, stützte das weiche zerschrammte Gesicht an einen splittrigen Bambuspfosten.
Still saß Wang-lun, als Ma zurückkehrte, auf dem Rand des Karrens und blickte ins Licht. Der Priester sah zu seinem Schrecken, daß Wang ein großes Kriegsschwert trug und es mit beiden Händen vor sich gestellt hielt. Wang-lun war gealtert; sein Blick reglos. Er rieb sich das Knie, und als er später aufstand, sah Ma-noh, daß er links hinkte.
Der Mann aus Hun-kang-tsun brummte, er sei jenseits des Hu-toflusses von übenden Soldaten gesehen und erkannt worden, er habe über den Fluß schwimmen müssen und sich beim Sprung über die Uferfelsen das Knie zerschlagen. Es war nicht ganz richtig; er hatte sich zwar bei dieser Jagd das Knie zerschunden; aber die Hauptverletzung zog er sich zu, als er sich der Sumpfgegend näherte. Er begegnete Anhängern Mas mit einigen Mädchen auf der Straße; niemand erkannte ihn. Als sie ins Gespräch kamen, erfuhr er zum ersten Male, daß diese Bündler sich Gebrochene Melonen nannten; er führte das Gespräch mit dumpfer Erregtheit weiter, griff, als die Bündler sich betrübt abwandten, einen von ihnen an, hetzte die Mädchen fort. Auf das Hilferufen trat ein rodender Bauer aus dem Bambusgehölz, warf quer über die Straße nach Wang einen Wurzelkloben, zerschmetterte ihm fast das Knie, an dem er schon litt. Dann floh auch der Bauer, der bei Ansichtigwerden des Schwertes glaubte, einen kaiserlichen Soldaten verwundet zu haben. Wang trug einen blauen Kittel mit roten Aufschlägen, den ihm ein desertierter Soldat aus der Truppe Ngohs geschenkt hatte.
Wang, unbeweglich auf dem Karren sitzend, fragte Ma-noh, ob sie auch viel unter den Verfolgungen von Truppen zu leiden hätten. Ma wollte, als dicke schwarze Blutstropfen durch Wangs Hosen quollen, ihm Wasser und ein stillendes Pulver bringen; aber Wang hielt ihn kopfschüttelnd zurück und meinte, indem er zu sprechen fortfuhr, es sei ja gleich, von wem die Brüder und Schwestern zu leiden hätten, von den Tao-tais oder von anderswo. Oder was Ma-noh meine? Das Schicksal sei hart und nicht zu beugen. Es sei gut, die Brüder zu lehren, den Weltlauf unangetastet zu lassen; aber dies sei nicht so gemeint gewesen, selber das Schicksal zu spielen und andere und die Brüder und Schwestern es ertragen zu lassen. Diejenigen, die glaubten, auch dann noch unangetastet zu bleiben, könnten sich in schweren Irrtümern wiegen. Ja, sie müßten und sollten sich in einem Irrtum wiegen, der sie mehr als einen blutigen Tropfen kosten könnte.
Ma-noh, sich auf die Matte kauernd, hörte ihn ohne aufzublicken an. Er sah den ungeschlachten Bauernburschen vor sich, der eines Wintertags auf dem Nan-kupaß die kleine Stiege zu seiner Felsenhütte heraufkam; er bettelte und ging nicht von seiner Türe weg, fragte nach den goldenen Fos auf dem Regal.
Er wurde von einer heißen Liebe zu Wang erfüllt, wollte sich einer Empfindung hingeben, die unter dem rauhen, wohlbekannten Schan-tungdialekt Wangs aufatmete mit einem „Endlich! “ aber blieb still sitzen, sann und wunderte sich nicht einmal, daß er nachdachte.
So verändert habe ich mich, dachte Ma-noh. Die Täler und Berge der achtzehn Provinzen sind breit und unermeßlich weit, den Schlüssel zum Westlichen Paradies trage ich; Wang-lun und ich müssen in Frieden voneinander lassen.
Er sagte, Wang-lun sei sehr lange fort gewesen; der Schutz der Weißen Wasserlilie sei wichtig, aber wichtiger die Leitung der Brüder und Schwestern, auch schwieriger vielleicht. Wang-lun möge nicht bitter werden; man könne Regeln leicht und in Menge aufstellen; es hätte sich gezeigt, daß die Regeln des Nan-kugebirges bei aller Kostbarkeit sich nicht allen Verhältnissen anpaßten; man hätte sie ändern müssen, Wang-lun könne sich überzeugen, daß man im Wesen gleich geblieben wäre, als käme man eben um die Schönn-i-Klippen herum. Wang-lun gelte als ein vollendeter Heiliger; er möge sich nicht in Zorn über sie ergehen.
Es war Ma-noh unverständlich, was ihn trieb, Wang zu quälen, und ihn einen Heiligen zu nennen. Er konnte sich nicht verhehlen, daß er die Wendung auf der Zunge wie eine süße Dattel zerdrückte und mit kaltem Vergnügen schmeckte.
Wang stand in Schmerzen; er stocherte mit seinem Schwert in dem Moos. Dies hatte er nicht geglaubt, nicht dies. Dieser Mann schien ihn anwerfen zu wollen.
Er glitt leidend auf die Matte neben Ma; der Priester streifte ihm gegen seinen Willen die Hose auf, holte einen Krug und Leinen, wusch das Knie.
Wang beobachtete ihn: „Ma, wir haben einmal auf dem Nan-kupasse nebeneinander gesessen; das waren wir doch, du und ich? Oberhalb der kleinen Pochmühlen wohntest du. Wir waren miteinander befreundet? “
„Wir sind in die Felder und Wälder von Tschi-li hinausgegangen, Wang. Tausende sind aus den Städten, aus allen Präfekturen, Distrikten zu uns gekommen, um unsere Freiheiten und wahrhaftigen Unabhängigkeiten zu kosten. Wir haben Gefängnisse mit List, Geld, Betrug öffnen müssen, um Brüder von uns zu befreien. Keiner von ihnen wäre gekommen und wir hätten umsonst gearbeitet, wenn wir nur ein anderes Gefängnis gebaut hätten, aus alten trockenen Worten, verhärteten Regeln. Das war nicht deine Absicht. Und wenn es deine war, so wäre sie es nicht geblieben, wenn du uns begleitet hättest vom Nan-ku herunter bis an den Sumpf von Ta-lou. “
Wang griff nach Ma-nohs Kinn.
„Ma-noh, wer, sagst du, hätte seine Absicht geändert, wenn er mit euch, die südwärts gezogen sind, vom Nan-ku bis zum Sumpf von Ta-lou gewandert wäre? Wer hat sie denn geändert? Wie viele und wie gute waren das? Ma, es gibt zweierlei Arten von Menschen; die einen leben, und wissen nicht, wie sie es machen sollen, die andern wissen, wie sie es machen sollen. Das sind wir, die kein Recht haben zu leben, die für die andern da sind, jawohl, Ma-noh, selbst um den Preis, die höchsten Khihs zu verlieren. Jedem ist sein Amt vorgeschrieben. Was dir und mir vorgeschrieben ist, haben wir auf deiner Hütte über den kleinen Pochwerken gewußt. Es brauchte keine Wanderung durch Tschi-li für dich und keine Begleitung für mich, um das zu lernen. Du sollst nicht deinen Bohnenbrei essen und dich neben ein Weib werfen und nach dem Westlichen Paradiese laufen. Ich dachte, das wüßtest du schon. Uns ist das alles versagt. Uns ist etwas anderes gegeben, nämlich dies alles zu wissen. Aber ich will nicht zornig werden, mein Bruder Ma-noh. “
„Du wirst nicht zornig werden, Wang. “
„Du weißt nicht, warum ich nicht zornig werde. Vorhin, bevor ich in euer Tal einbog, bin ich über ein Feld mit Thymian gegangen. Ich fand nicht gleich zurecht, deine Boten waren vorausgelaufen, mein Knie schmerzte, ich konnte nicht rasch nachkommen. Ich saß einen Augenblick auf einem Maulwurfshügel. Was nun kommen würde, unser Gespräch, unser Wiedersehen, verwirrte mich etwas. Einen Moment schien es mir, ich müßte einem Feldschatten verfallen, der mir hier aufgelauert hatte. Wie ich wieder die Augen aufmache, sehe ich eine breite Lichtschnur in lauter bogigen Windungen quer über das Feld. Dicht bei meinem Maulwurfshügel fing es an, ein kleines niedriges Flimmern, das nicht stillstand. Das waren Leuchtkäferchen. Die Natur ist nicht gegen uns. Ich will heut nacht warten, ob mir der König der Leuchtkäferchen im Traum erscheint und will mich bei ihm bedanken. Vielleicht waren es hilfreiche Geister aus dem Sumpf, die mich sahen, wie ich hinfällig war; sie sind selbst so arm. Das Flimmern führte bis in dein Tal. Ich bin nicht zornig; ich bin nicht verlassen. “
„Wang, du wirst dich nicht gegen mich wenden. Vor wenigen Wochen dachte ich ja wie du: sie die Körner, wir die Wurfschaufel, sie der Kopf, wir die Mütze, sie der Fuß, wir der Pfad. Dann sind Dinge gekommen, deren ich mich schwer entsinne, — daß sich der Hut, wirst du sagen, des Kopfes bemächtigt hat, und der Weg vor dem Fuß davongelaufen ist. Ich weiß, daß ich dir Rechenschaft schuldig bin dafür, ja, lehn es nicht ab, bin dir Rechenschaft schuldig. Aber ich kann dir keine geben, denn ich vermag mich nicht, auch wenn ich mich anstrenge, nicht darauf zu besinnen. Es ist vor mir ausgewischt, wie eine Tusche vom Regen. “
„Die schlechte Tusche“, unterbrach ihn Wang, der lächelte. „Und wie heißt der Regen, lieber Bruder? “
„Nicht Untreue. “
„Der Regen heißt Eitelkeit und Herrschsucht; Eitelkeit und Herrschsucht wollte ich sagen. “
Wang hielt Ma-noh, als sie so nebeneinander kauerten, bei den Schultern und prüfte unsicher Mas dürres Gesicht. Sie sahen sich zum erstenmal voll an. Wang schien ernster und trauriger zu werden; er hielt vertieft den Kopf schräg; nahm in einer mitleidigen Aufwallung Mas Hand und streichelte sie: „Wie heißt der Regen, Ma-noh? Was ist dir begegnet? “
„Du warst so lange fort. Wir haben als Wahrhaft Schwache gelebt. Die Frauen sind gekommen. Was den andern Brüdern begegnete, weiß ich nicht. Ich wußte von einem Tag an, daß ich — nicht mehr — ohne Begierde — war. Ich wollte es wieder sein. Das Leben ist ja kurz. Man darf nicht zu lange falsch gehen, man kann nicht die Tage wie Kupferkäsch zählen und für Reis und Hirse eintauschen. Nun bin ich wieder ohne Begierde, ich habe mich gesättigt, muß mich immer wieder sättigen; ich weiß, du brauchst es nicht zu sagen, es ist endlos: aber ich kann frei und rein beten und hoffe, daß mein Einsatz schwer genug wiegt auch mit den Gelüsten. Schimpfe nicht, Wang. Ich weiß, daß mich niemand verachtet. “
„Das waren die Frauen. Bruder Ma-noh, ich verachte dich nicht darum. Aber du bist noch nicht zu Ende, du wolltest wohl noch weiter reden. Du liefest zu der Frau, nach der dich hungerte. Dann nahmst du sie und gingst deiner Wege, nach Nan-ku zurück, oder in ein Dorf, eine Stadt? Niemand wird gezwungen, zu uns zu kommen. Jeder kann gehen, wenn es ihn drängt. Nicht wahr, so tatest du? “
Ma-noh, mit halbem Gehör folgend, redete grübelnd weiter: „Was Begierden sind, habe ich vor langer Zeit gewußt. Aber was Frauen sind, war mir unbekannt. Frauen, Frauen. Du bist nicht, Wang, wie ich, von Kindesbeinen in der Schule des Klosters gewesen. Man seufzt, und weiß nicht warum. Man wirft sich im Mondschein in vieler Unruhe, und schließlich seufzt man nach der — Kuan-yin, ängstigt sich um die — zwanzig heiligen Bestimmungen. So vergißt man sich. Jetzt sind die Frauen gekommen. Ich glaube, sie haben mich manchmal vom Morgen bis Abend umschlungen, geweint, mich um wunderbare Formeln gebeten. Bis ich sie beruhigt hatte und sie unsern Weg wußten, vergingen Wochen, und dann kamen neue. Sie gingen meinen guten Weg, schließlich. Mir ließen sie einen Druck zurück auf der Schulter, ein dünn gequetschtes japsendes Herz, ein Schwitzen an den Händen. Ich ging ihren Weg. Es sind Stärkere zu dieser Arbeit nötig, mich hat Pu-to-schan verdorben. Da sieh, neben uns auf den Karren, wer da steht! Stehen sie noch? Dieser Ratterkasten ruht von seiner zwanzigjährigen Wanderschaft, die Götter drücken ihn im Schlaf. “
Ma-noh griff, ohne sich aufzurichten, neben sich an die Deichsel des Karrens, ruckte daran. Die goldenen Buddhas wackelten, stürzten nach beiden Seiten an den Boden, purzelten über- und nebeneinander. Zuletzt fiel mit einem scharfen Geräusch die Kuan-yin aus Bergkristall hintenüber. Sie sprang, hart auf einen abgebrochenen Buddhakopf schlagend, mitten entzwei; ihre Arme splitterten.
Wang suchte Ma-nohs Gesicht. Aber der hatte sich über sich gebückt und redete, als wäre nichts geschehen.
„Obwohl es mir so ging, wollte, konnte ich dich nicht verlassen. Es ist sinnlos, mich zu bestrafen, nein, mich auszustoßen für die Ewigkeit, weil ich so schlecht aufgezogen bin. Es muß ein Ende nehmen damit. Die heiligen Bücher können nicht gelten. Es muß eine Lösung geben. Ich wußte die Lösung. Die Keuschheitslehre ist ein Wahnsinn, keine kostbare Regel, eine Barbarei. Die Brüder und Schwestern haben mir zugestimmt. “
Wang zuckte. Er warf sich halb nach der Wand zu, so daß ihn Ma-noh im Schatten nicht erkennen konnte. Sein riesiges Kriegsschwert lag schräg über dem Knie, dessen dünner Verband hellrot durchblutet war.
Das Schwert hatte ihm Chen-yao-fen in Po-schan gegeben, als er sich verabschiedete. Es hieß der Gelbe Springer. Es vererbte sich in der Chenfamilie und forderte den Besitzer auf, an die Traditionen der Weißen Wasserlilie zu denken.
Eine gerade doppelschneidige Klinge; in ihrer Oberfläche sieben runde Messingscheibchen eingelegt; dicht an der Wurzel unterhalb eines Sternmusters Lotosblätter. Der goldbeschlagene Griff nach der Mitte zu anschwellend; beiderseitig die Charaktere der Mings, Sonne und Mond, aus feinem Silberdraht; die Parierstange mondförmig. Der Knauf prächtig endend in einen züngelnden Drachenknopf.
Wang sagte nicht, was ihn bewog, sich nach einem Schweigen aufzurichten und, das Schwert wegschiebend, Ma-noh hart und unbarmherzig die wagerecht gestreckten Arme wie Balken über die Schultern zu wuchten und den Bruder in einer Klemme zu halten. Wangs Zähne klapperten; ein stoßweises Zittern warf seine Hände, die nach dem Schwertknauf greifen wollten, um Ma-noh die Klinge in den zugekniffenen Mund zwischen die Lippen zu zwängen, sie rasch im Schlund umzudrehen, zu bohren, herauszuziehen und über die ledernen Backen zu schlagen.
Ma-noh sank vornüber unter dem Druck. Er erwartete finster, was weiter geschehen würde. In einem bösen gehässigen Gefühl blieb er sitzen, als Wang die Arme abhob und seufzend das kranke Knie streckte.
Wang fing einen giftigen Blick Mas von unten auf. Sein Gesicht wie unter einer federnden Polsterung schwoll hoch. Er zog sich mühsam an seinem Schwert auf, die blutunterlaufenen Augen flackerten. Er zeigte mit beiden Händen auf Ma herunter: „Du, du bist der Verräter, du bist ein Betrüger, ein Verführer, bleib nur ruhig sitzen, das ist statt langer Erklärungen alles und jedes in einem Wort. Ich hätte es dir schon vor drei Tagen gesagt, als ich von euch hier gehört habe. Du hättest die Lösung in deiner jämmerlichen Not nicht suchen brauchen; ich hätte dir gleich sagen können, daß du alle Welt, jeden Freudenhimmel und jede Seligkeit verraten würdest, um neben deiner Frau auf dem Stroh zu liegen. Denn du bist giftig, ein Skorpion von Natur; ich bin schuld daran, allein ich, der dich gewähren ließ unter den Wahrhaft Schwachen. Ich bin die Säule, die alle tragen muß, ich bin der Himmel, der undurchbrechbar über den Armseligen ruht und selbst nichts hat von seiner Sonne und den Gestirnen. Ich habe mich entschlagen von mehr, als du weißt, Ma-noh, von mehr als einem Weib und tausend Weibern; von mir selbst hab ich mich abtrennen müssen, von meinen Armen, meinen Beinen, von meiner Geburt und Vergangenheit, hab meine eigenen weißen Därme in ihre Bäuche gewühlt und mich ausgeblutet. Mit Gewalt hab ich das tun müssen.
Die glücklichen Inseln werde ich nicht erreichen, das Chikraut kann blühen wo es will, nichts ist jetzt mehr, nichts darf mehr sein, was ich erlebt habe. Unbeerdigt ist der ernste Su-koh gestorben. Die obdachlosen Geister müssen vor mir abweichen, denn ich bin selbst leer, ein vergilbtes Blatt, ein Drache aus Papier, bunt bemalt und mit einer Heulsirene im Maul, wie ihn die Leute im Süden vor Leichenzügen tragen. So bin ich, daß ich selbst Schrecken vor mir erlebe, wenn man mich ruhig auf einem Stein sitzen läßt, daß ich mich für einen schwirrenden Kwei halte, der einen frischen Menschenkörper sucht.
Aber du, Ma-noh, bist nichts von dem. Wohl dir. Ja, dir blitzt die Hoffnung aus den Augen, und in deinen Eingeweiden sitzt das Vergnügen. Du bist kleiner als ich, du bist dürftiger als ich, trockener als ich, aber prahlst vor mir mit deinem Leben.
Ich bin dir begegnet, Ma-noh, vor zwei Tagen. Du warst es, nicht wahr, gestehe es, du warst es! An einem Weiher, zwischen zwei Weidenbäumen ist es gewesen. Du warst der Kranich, der nicht von mir abweichen wollte, der vor mir ab und auf spazierte mit stolzen Beinen, mit scharlachroten Beinen, und Frösche spießte. Du trugst ein weißes Kleid und blicktest listig mit gelben Augen aus deinem blutroten Kopf heraus. Und dann, nachdem du vor mir gefressen hast und ich dich in Ruhe gelassen habe, hast du dich erhoben in die Luft und deinen schwarzen Mist auf meinen Kittel und meine Sohlen fallen lassen.
Du böser Schatten, du Kwei, du wirst mich nicht zunichte machen, sag ich dir. Das wirst du nicht, sag ich dir! Der Kwei wird an mir vorüberhuschen müssen. “
Wang, das kranke Knie angezogen, fuchtelte mit seinem Schwerte herum. Er flüsterte scharf, mit Abscheu dem kauernden Priester in das ihm entgegengehobene Vogelgesicht. Jeden Satz warf er mit Genugtuung besinnungslos auf den Priester wie eine Handvoll gestoßenen Pfeffer. Durch das, was er sagte, klang die eiserne Wut.
Ma-nohs Haß auf diesen Mann stieg ins Maßlose. Ab und zu spitzte er höhnend seinen Mund, spannte sich zu einem todesmutigen Sprung, fiel traurig zurück, härtete sich kalt. Er rührte sich nicht, beschloß, sich nicht vom Fleck rühren zu lassen.
„Wenn mein Bruder Wang heute nacht dem König der Leuchtkäferchen im Traum begegnet, so wird er nicht nötig haben, ihm zu danken. Ein weiser alter Mann aus der Hanperiode lehrte: der Weg im Zorn beschritten wird vergeblich sein. Mein Bruder Wang trägt ein Kriegsschwert an der Seite. Er sagt, er müsse ein Kriegsschwert führen und dürfe sich nicht dem heiligen Tao nähern. Mein Bruder mag an meiner kläglichen Ruhe merken, daß ich mehr dazu neige, geschlagen zu werden als zu schlagen. Sein Schwert scheint mir eine besessene Seele zu haben, die ihren Herrn verführt in einen Sumpf. Wie auch immer: dieser Ma-noh aus Pu-to-schan wird niemals ein Schwert berühren, und es wird ihn nie jemand dazu reizen können. Denn er ist zu schwach für den tobsüchtigen Geist eines Schwertes. Ma-noh geht dem Tao nach, als käme er eben um die Schönn-i-Klippen herum, — als wenn er eben erst die Worte eines Mannes hörte, der wie ein Boddhisatva sprach, Wang-luns Worte: ‚Ein Frosch kann keinen Storch verschlucken. Gegen das Schicksal hilft nur eins: Nicht widerstreben, schwach und folgsam wie das weiße Wasser sein. Wir wollen auf eine Spitze laufen, die schöner ist, als die ich sonst jemals gesehen habe, auf den Gipfel der Kaiserherrlichkeit. ‘ Auf diese Spitze läuft unbeirrt Ma-noh. Und weil Ma-noh nicht ohne Gelüste nach den Frauen blieb, so läuft er mit den Frauen. Aber auf den Gipfel muß er gelangen, wird er gelangen. Du magst dich abwenden von mir, Wang-lun; süß sind mir die Frauen, mein Auge hängt an ihnen wie an den Farben der Orchideen, ich habe niemals so rein gebetet wie seit dem Augenblick, wo eine auf diesem Strohsack neben mir lag. Keine Versenkung auf Pu-to-schan, die ich sah und die ich erlebte, keine Entrückung ist so voll Macht gewesen wie meine seit diesem gemeinen Augenblick. Der Durst meiner Kehle ist so wenig böse wie das Gelüste meiner Hände und meines Schoßes. Cakya-muni hat sich geirrt. Mir steht das fest. Wenn ich dir auf Nan-ku anderes von den goldenen milden Buddhas erzählte und du es aufnahmst, so habe ich dich Schlechtes gelehrt, und es ist nur recht, daß es auf mich zurückfällt, wenngleich es mich nicht beirren wird, Wang-lun. Wir gehen nicht mehr gemeinsam, Wang-lun. Quäle dich nicht und quäle mich nicht. “
Wang-lun saß in steinerner Ruhe auf dem Karren. Das lange Schlachtschwert lag im Moos auf zerbrochenen Buddhaköpfen. Es war Wang klar, was geschehen mußte; es war Ma-noh klar. Darum sprachen sie nicht mehr.
Er bat Ma-noh, ihm kaltes Wasser für sein Knie bringen zu wollen und morgen einen Arzt zu bestellen. Ma schleppte mit zwei andern Männern Haufen von Gras in die Hütte. Sie sahen sich, bevor sie sich schlafen legten, ernst an und grüßten einander. Sie standen nebeneinander. Dann warfen sie sich hin.
Wang blieb vier Tage bei den Gebrochenen Melonen, die sich rüsteten weiter südlich zu wandern. Er beobachtete sie, lernte die Mehrzahl dieser Anhänger kennen. Er widersprach ihnen nicht, redete wortkarg und sehr versunken von dem schweren Weg der Wahrhaft Schwachen. Als sie ihn fragten, warum er, der sich widerstandslos wie sie dem Schicksal beugen wolle, die Jacke eines Soldaten und ein Schlachtschwert trage, antwortete er lächelnd, daß sich viele Leute maskieren, um Böses abzuschrecken. Am Tage des Chü-juan, am fünften Tag des fünften Monats wüten die fünf giftigen Tiere, die Schlange, der Skorpion, Tausendfuß, die Kröte und Eidechse; da reiben die ängstlichen Mütter den Kindern Schwefelblüte mit Wein in Ohr und Nase und malen das Zeichen „Tiger“ auf die Stirnen; aber sie wollen damit nicht sagen, daß ihre Kinder wilde Tiger seien.
In ihm war seit dem Tage, wo er das Nan-kugebirge unter Schneestürmen verließ, bis zu diesem Sommermonat eine Umwälzung vorgegangen. Ma-noh bemerkte schon, als sie in der Gerätekammer zu Pa-ta-ling saßen, wie sich in Wang ein erbarmendes Gefühl für die Brüder festsetzte, die ihm vertrauten. Wang machte die wechselvolle Reise durch Tschi-li und Schan-tung. Je mehr er litt, um so mehr drängte es ihn heraus aus der Rolle des friedlichen Wahrhaft Schwachen, der seiner Seele ein reines Kleid bereiten will. Es befestigte sich in ihm die Haltung des Verteidigers seiner Brüder. Er mußte kämpfen für die Ausgestoßenen seines Landes.
Dicht bei Tsi-nan-fu trat die Versuchung an ihn heran. Er konnte seinem Drange, der sich schmerzlich und glückselig durch seine Brust senkte, nicht widerstehen, stieg, das Gesicht mit Kohle beschmiert auf die Landstraße, die von Osten nach Tsi-nan-fu führte. Trabte einige Zeit allein, wartete auf einen Wagenzug, mit dem er sich in die Stadt einschmuggeln könnte. Es kam keiner um diese Tageszeit, denn Ölwagen, Frucht-, Gemüse- und Kohlenzüge pflegten schon in den ersten Morgenstunden in Tsi-nan einzufahren. Ehe sich Wang in einem sonderbaren Leichtsinn ganz dem östlichen Stadttor genähert hatte, wurde er von zwei Polizisten beobachtet, die ihn an seiner großen Figur, seinem schaukelnden Gang erkannten, ihm folgten und mit einem Torwächter festnahmen, wie er gerade, als wäre er Bürger von Tsi-nan-fu, gleichmütig und langsam durch das Osttor segelte.
Wang sah durch das handgroße Gitterfenster des Kellers, in den man ihn geworfen hatte, die breite gewundene Handelsstraße mit den Läden, den lärmenden Ausrufern und dem vielfarbigen Gewimmel, unter dem er selbst seine Späße, Künste und Betrügereien geübt hatte. Zur linken Hand mußte der Markt liegen, auf den die Straße mit dem Tempel des großen Musikfürsten Hang-tsiang-tse führte. Geradezu war die Richtung zur Herberge, zu Su-kohs Haus, das eingeäschert lag. Dann der Übungsplatz der Provinzialtruppen.
Und jetzt überfiel Wang die Versuchung: hier zu bleiben, die Gerichtsverhandlung abzuwarten, die Strafe des Zerschneidens in Stücke zu erdulden. Er konnte sich keine Rechenschaft darüber geben, warum ihn dieses leidenschaftliche Verlangen überfiel. Er wollte, im Gewimmel dieser feilschenden Menschen, zwischen all dem Klappern, den Gongschlägern, den Ausruferstimmen sterben, hier in seiner Heimat. Er dachte in diesem Keller über seine veränderte Lage nach. Wie er vor Monaten die Nan-kugefährten verließ, wie er an Chen-yao-fens prachtvoller Tafel vor kaum zwei Wochen speiste, und wie der Tou-ssee umgekommen war und Su-koh, und wie er betrogen, gewütet, gestohlen hatte. Und das schien ihm alles unerträglich, und wohltuend, ein Glück, hier viel zu erdulden, alles bis zu Ende auszuerdulden.
In der Eile seiner Verhaftung hatten die Polizisten und der Torwächter ihn eingesperrt, ohne ihm sein Schwert abzunehmen. Die drei waren froh, als sie den berüchtigten Mörder im Keller hatten. Erst als die beiden Polizisten schon ins Jamen und auf die Stadtkommandantur liefen, um dem Tao-tai und dem General die außerordentliche Verhaftung mitzuteilen und sich Belohnungen zu sichern, fiel dem alten Torwächter auf seiner Bank ein, daß Wang ein Schwert bei sich trug. Er nahm eine kleine Keule von seinem Fensterbrett, die ein Viehtreiber morgens hatte liegen lassen, versteckte sie unter seinen Ärmel und ging auf bloßen Sohlen hinunter; er wollte Wang das Schwert stehlen; wenn es kostbar war, verkaufen, sonst es nur auf der Präfektur vorzeigen und sich seinen Mut belohnen lassen.
Er öffnete das Vorhängeschloß des Kellers. Die Mäuse liefen ihm zwischen die frostkranken nackten Füße, hüpften an seinen Hosen hoch. Wang saß drin auf dem Boden und sah dem alten Mann zu. Der Wächter trat näher, fragte, wie er sich fühle, ob er krank sei, prüfte seinen Gesichtsausdruck. Das Schwert lag in den Raum geworfen weit von Wang entfernt nach der Tür zu.
Wang dankte; er freue sich, wieder in Tsi-nan zu sein. Und wie es dem Herbergswirt gehe und welcher Markt jetzt am meisten besucht sei.
Dem Herbergswirt ginge es erfreulich gut, — jetzt erkannte der Wächter das Schwert, rutschte seitlich davor, tastete mit den Händen rückwärts nach dem Knauf, — und von dem ehemals so beliebten Goldblättermarkte sei die Blumenherrlichkeit verschwunden, seitdem die Gilde der Blumenverkäufer die hohe Platzmiete verweigert hätte. Alles spiele sich jetzt in dem weiten Hof ihres eigenen Gildenhauses ab.
Es sei erstaunlich, meinte Wang, wie rasch sich die Stadt verändere. Aber die Torwächter blieben doch gleich. Sie stehlen, was ihnen in die Hände fällt. Nur dies Schwert möchte er nicht stehlen, sofern er die Gnade hätte, es zu unterlassen. Denn es sei Eigentum eines Mannes im östlichen Schan-tung, dessen Namen er ihm nennen werde, wenn er verschwiegen sei und gegen eine hohe Summe das Schwert dem Besitzer zurückbrächte.
Der Wächter, katzebuckelnd vor dem Gefangenen, flüsterte schon, man könne sich auf ihn verlassen. Und wenn Wang auch eine ehrenvolle, wenngleich heimliche Beerdigung wünsche an einem leidlich günstigen Ort, so möchte er es ihm nur sagen, bevor die Polizisten mit dem Transportkäfig kämen; er hätte schon vielen geholfen.
Man hörte draußen lautes Klagen und Keifen. Wang sah durch das Gitter. Ein Bettelvogt schlug auf zwei Arme mit einem langen Stab ein. Ein Mandarin mit Blauknopf sah aus einer Sänfte zu und wies auf die beiden, die betrügerisch in seinem Hause, in einem fremden Bezirk und zweimal am Tage gebettelt hätten.
Wang seufzte, kauerte hin, sagte nachdenklich, die Stadt hätte sich doch wenig verändert. Schüttelte sich resolut, und nun ging er auf den Torwächter zu, den er bei den Schultern anhob. Als der Alte ihm die Keule gegen die Brust schlug, meinte Wang, es sei doch besser sich nicht anzustrengen, legte den kreischenden Mann auf das Gesicht, drohte am offenen Tor draußen, in die Stadt hineingellend, dem Bettelvogt und dem Blauknopf mit der geschwungenen Waffe, verschwand von Tsi-nan-fus Mauern.
Es hat keinen Sinn zu sterben. Man kann es nicht laufen lassen. Der Vogt hat unrecht und die Bettler haben unrecht. Sie weichen beide vom Tao ab. Einer muß anfangen mit dem rechten Weg.
Nun folgte das Hin und Her der Wanderschaft. Wang suchte auf geradem Wege in die Gegend südlich der Nan-kuberge zu gelangen. Aber das Gerücht von ihm verbreitete sich.
Man veranstaltete Treibjagden auf ihn, nachdem seitens des Tsong-tous von Schan-tung angeordnet war, daß die Präfekten derjenigen Bezirke, die Wang passierte ohne ergriffen zu werden, hohe Strafen zu zahlen hätten.
Gehetzt und erst allmählich der Gefährlichkeit seiner Lage bewußt, insbesondere als er merkte, daß der Ruf der Wahrhaft Schwachen sich über Tschi-li und Schan-tung verbreitet hatte, und jedermann wußte, daß er sich mit den nordwestlichen Brüdern vereinigen wollte, begann Wang die Taktik des Alleinwanderns aufzugeben. Er betrachtete es als seine Aufgabe, sich wie auch immer in die nördliche Ebene durchzuschlagen. Eine abergläubische Regung verband ihn mit dem Schwerte; der Gelbe Springer sollte ihn tragen. Es gab zwei Länder auf der Welt: das eine war die kleine Ebene südlich Nan-ku, das andere war eben alles andere Land, war Wasser, durch das er schwamm auf dem Rücken des Gelben Springers.
Er setzte, als er einmal zwei Tage sich nicht aus einer Höhle herauswagen konnte, in Furcht, von den Bauern, die ihn kannten, gefaßt zu werden, vor sich fest: „Was außerhalb des Bereichs meiner Brüder geschieht, unterliegt anderen, eigenen Gesetzen. Ich bin arm, leidend, nur unter ihnen, ich muß zu ihnen. Diesem Lande, diesen Wellen versage ich meine Gesetze. “
Schlug sich dicht vor den Toren zu einer Bande schlimmer Gesellen, die es sich zum Geschäft machten, ganze Ortschaften zu brandschatzen, Geiseln zu rauben und Lösegeld zu erpressen; die wie die mandschurischen Chungusen im Sommer allenthalben auftauchten, im Winter sich in die Städte verstreuten. Es wollte das sonderbare Geschick, das über diesem schicksalsreichen Menschen waltete, daß er um dieselbe Zeit eine gefährliche Bande anführte und mit ihr von Ort zu Ort vordrang, als im westlichen Tschi-li in die idyllischen Träume seiner Brüder ebensolche Horden die erste Angst hineinjohlten.
Anderthalb Monate begrub er die Erinnerung an die eisigen Wintertage; inmitten des sanftesten Frühlings zog er von Verbrechen zu Verbrechen. Keine Unruhe befiel ihn. Als drei Tagereisen von einem Wald entfernt, wo die erste Truppe der Wahrhaft Schwachen lagerte, die wilden Burschen ihn zu einem Überfall auf einen reichen Wanderer, den gelehrten Chu-tuk-tu aufforderten, der grade mit großem Pompe eine Inspektionsreise über die lamaischen Klöster Tschi-lis machte, entschloß sich Wang, sich von ihnen zu trennen.
Er weigerte sich, an dem Unternehmen teilzunehmen. Sie umringten ihn, es war frühmorgens in einem schönen Flußtal, stellten ihn zur Rede, warfen ihm Feigheit vor. Er machte sich mit ruhigen Bewegungen den Rücken frei, erklärte, daß er in drei Tagereisen seine Freunde erreichen würde, lehnte ab, sie mitzunehmen. Dies waren die Wellen, er wollte Land. Sie fingen an, das weichliche Wesen der Brüder zu verspotten, fragten Wang, wo die Almosenschale wäre, sie wollten etwas hineinlegen, lachten.
Wang ging von ihnen. Nach zwei Li versperrten ihm fünf von ihnen den Weg, begannen das Höhnen wieder, indem sie zugleich verdächtig mit ihren Bogen hantierten. Als ihm einer in der fettigen Mütze einen abgeschnittenen Zopf zum Andenken hinreichte, hielt es Wang für richtig, mit einem großen Satz an Land zu kommen.
Er fluchte auf das Land, das er verließ, spie sein Schwert an, wie einen Toten, den man zum Leben erwecken will, hob es mit beiden Armen hoch auf, krachte dem Gabenverteiler in die Brust. Als er den Knauf losließ, stand er allein mit dem Toten am Wege. Er zog die Schneide zwischen die Lippen; das Land, das er verließ, spritzte heiß nach ihm; er leckte das glückverheißende Blut.
Lief stundenlang ohne Unterbrechung, der Gelbe Springer ihm voraus. Bis der Abend kam, und er sich ohne Hunger im Walde niederlegte. Nach zwei Tagen, in denen dem Verwahrlosten ängstliche Frauen, die ihm begegneten, Früchte und rohen Reis reichten, umging er bei Anbruch des Abends eine Wiese, aus der ihm das Singen und Rezitieren von Sutras entgegenscholl. Er erkannte neben einem Feuer den jungen Buckligen aus Nan-ku. Es war eine große Truppe.
In der Nacht, bevor er Ma-nohs Haufen verließ, kamen zwei Mädchen in sein Zelt. Sie leuchteten mit gelben Papierlampions an Bambusstäben über sich, lehnten die Lampions heimlich in eine Ecke. Sie wühlten den schlafenden Mann aus dem Strohhaufen heraus, rieben ihm die Augen, sahen nebeneinander kauernd aufmerksam zu, wie er sich aufrichtete, vorsichtig sein krankes Knie herumbewegte und langsam anfing zu lächeln.
Er trug einen langen braunen Kittel, seine groben Füße waren bloß. Jedes Mädchen nahm eine Hand von ihm und zog ihn in die Höhe, so daß er jetzt beide in die Arme nahm und sich auf die nachgiebigen runden Schultern stützte. So gehalten, die Köpfe aneinander gedrückt, warfen sie sich furchtsame Blicke zu. Die Jüngere im linken Arm zitterte und suchte die Finger der anderen zu fassen. Sie dachten beide, der schreckliche Zauberer würde mit ihnen durch das Zeltdach fahren oder als Schlange sich um ihre Hälse ringeln.
Aber Wang ließ sie los, strich ihnen nacheinander die geradegeschnittenen Ponys auf den Stirnen glatt. Sie waren entzückt. Die Jüngere schüttelte sich und knirschte mit den Zähnen. Sie kniffen in seine Arme, die er ausgespannt zwischen ihnen hielt. Sie tasteten rechts und links seine Muskeln ab, schoben sich an seinen Ellenbogen hoch, schwebten, indem die Ältere noch rechtzeitig den Brustausschnitt von Wangs Kittel erwischte, als die Jüngere schwankend an ihrer Schulter zottelte. Plötzlich bückte sich die Jüngere, die über Wangs Vorderarm schaukelte und mit den Fingern seine Brusthaut kratzte und klöpfelte, vornüber, wobei sie die andere mit herunterzerrte, biß in den Vorderarm dicht am Handgelenk wie ein junger verspielter Hund in einen Knochen, rutschte interessiert auf die Füße und stand nun kauend und schnappend da vor Wangs unbeweglichem gelbbraunen linken Arm. Sie blickte schief auf in das Gesicht des Mannes, wartend, daß er einmal zuckte, erschreckt, daß er noch immer nicht zusammenfuhr. Die Härte schmerzte ihre Zähne. Sie schmatzte ermüdet mit den Lippen und beleckte sich.
Sie war aus Schen-si gebürtig, klein, flink, geschwätzig. Man konnte sie für einen Pudel halten oder für ein Kaninchen. Sie log gern und viel, auf eine gewisse dumme Weise, wie es ihr gerade einfiel. Sie war mit der anderen als Haussklavin auf dem Landsitz einer Familie bei Kwan-ping tätig gewesen, floh, als im Zimmer ihrer Herrin durch ihre Unvorsicht Feuer ausbrach, wagte nicht zurückzukehren, ließ sich vergnügt von drei bettelnden Schwestern zum Lager der Gebrochenen Melonen führen. Sie war faul, sagte ja zu allem, ließ sich nicht belehren.
Die andere, nicht größer als sie, aber voller, mit einer längeren Nase, viel feiner als die Jüngere, log nicht weniger, mehr in einer großsprecherischen prahlerischen Art. Sie neigte leicht zur Sentimentalität und zur Eigenbeweihräucherung. Von Zeit zu Zeit litt sie unter eigentümlichen Verstimmungen Monate hindurch, trug sich mit abenteuerlichen Vorstellungen und mit Selbstmordgedanken, schon von ihrem zwölften Lebensjahr an. Später nahm sie, als hätte sie etwas Großartiges erlebt, gern eine Märtyrermiene an, gestand aber leicht, wenn man auf sie eindrang, daß sie ohne Heimat, ohne Eltern und Sippe sich sehr quäle unter der Leere und Aussichtslosigkeit ihrer Existenz. Sie hielt sich für etwas Besonderes, hing innig, ja leidenschaftlich mit ihren Freundinnen zusammen, vertrug sich nur auf Wochen, galt als klug, schön und zänkisch. Wäre sie nicht in das Haus ihres ehrenwerten Herrn, sondern eines geschäftskundigen Mannes gekommen, so wäre sie längst an eine Theatertruppe verkauft, wo sie sich am glücklichsten entwickelt hätte.
Wang fuhr in seine Hosen und Sandalen. Die Mädchen wollten ihm helfen. Sie arbeiteten plappernd an ihm herum. Die Jüngere bot sich ihm in Erregung an, indem sie zwischen allerhand Gefrage erzählte, daß sie über fünfzehn Jahre alt wäre und froh sei, auf einen so furchtbaren Dämonenbezwinger gestoßen zu sein. Ach, sie wollte so gerne Blumen mit ihm pflücken. Wang meinte, er wolle darüber nachdenken, stieß, als sie ihn umsprangen, eine nach der andern hin. Der Jüngeren platzte am Hals und unter den Achseln der Kittel. Sie zeigte Wang erfreut und verschämt die armseligen Rundungen ihrer Brust. Die Sentimentale stand schmollend, da die Kleine sie immer mit der Schulter anwippte, sie weggehen hieß, ihr von rückwärts über die Nase patschte.
Als nun Wang die Kleine bei den Schultern ergriff, sie über den Moosboden herumwirbelte, das Mädchen schwindlig wurde und losgelassen hinschießend sich ihre zu straffe Hose aufschlitzte, schimpfte die Sentimentale; das hätte sie nicht in dem Hause ihres ehrenwerten alten Herrn gelernt. Wang nahm auch sie bei den Schultern. Sie riß sich aber los, sagte mit niedergeschlagenen funkelnden Augen, sie wolle einen Vorschlag machen. Sie wolle mit der Kleinen ringen oder Steine heben oder was die Kleine meine. Sie wollten sich messen. Der Mann hetzte sie aufeinander, dann setzte er sich in das Stroh. Sie mußten neben ihn kauern, er begütigte sie, liebkoste ihre glühenden Gesichter, die sich noch immer verbittert voneinander abwandten.
Er erzählte ihnen unter Getändel Geschichten, die er noch in Tsi-nan-fu gehört hatte.
Die ofenschwarzen Massen der Nacht lockerten sich. Ein graues dünnes Gas fugte sie auseinander und verteilte, verflüchtigte sie in große Räume. Der Katalpawald, abgedeckt, trat wie ein Bock hervor mit gesenkten Hörnern.
Wang legte den blauen Kittel an, hing sein Schwert um den Hals. Sie sollten laufen, ihre Almosenschalen und was sie sonst hätten, holen; sie müßten zusammen aufbrechen. Als er neben ihnen marschierte, langsam und mit Schonung des Knies, sagte er ihnen nicht, warum er so heimlich aufbräche und wohin sie gingen.
Er wanderte drei Wochen durch das mittlere Tschi-li, schickte Boten in viele größere Ortschaften und Städte, die schon von Schan-tung her benachrichtigt waren, daß die Wu-wei unter Wang-lun aus Hun-kang-tsun zu den Vaterlandsfreunden der Weißen Wasserlilie gehörten und auf jede erdenkliche geheime Weise zu unterstützen seien. Wangs Boten liefen als Feigenverkäufer; in ihrer schmalen langen Kiste lag zwischen einer Schicht von Feigen das Erbschwert Chen-yao-fens, der Gelbe Springer mit einem Brief Wangs in der verabredeten Schreibweise der Weißen Wasserlilie, in der je nach einem mündlich zu übermittelnden Zeichen nur der dritte und dann der siebente Charakter gelesen wurde; von einem bestimmten Zeichen an jeder zweite und dann der vierte. Die Geheimhilfe der Weißen Wasserlilie wurde in kurzer Zeit mobil gemacht; es herrschte unbedingtes Vertrauen auf das Komitee in Schan-tung.
Zugleich änderte Wang-lun seine Anordnungen für die Lebensweise der Brüder und Schwestern; er duldete und wünschte in ärmeren Gegenden die vollkommene Auflösung und Zerstreuung der Brüder und Schwestern in Ansiedelungen, Dörfer, Städte. Wang gab darin dem Wunsche zweier Mitglieder des Pelien-kao nach, die ihm antworteten, sie billigten nicht den strengen Abschluß der Wahrhaft Schwachen, ihr eulenhaftes Wesen; es sei nötig, daß man sich nicht nur brieflich verbünde; unter der Süßigkeit der Feigen liege doch kein Schwert. Aber Wang gab zugleich den Angesehenen aller Haufen heimliche Weisung, die Brüder und Schwestern vor ihrem Eintritt in menschliche Siedelungen zu warnen, sich den Brüdern der Weißen Wasserlilie gleichzustellen. Vaterlandsfreunde seien alle, aber die Wu-wei nur friedlich und leidend, die echtesten Kinder ihres armen Volkes, das niemand wahrhaft in Krieg verwickeln könne, weil es wie das Wasser immer flösse und die Form jedes Gefäßes annehme.
Nachdem Wang-lun im mittleren Tschi-li solchermaßen für die Sicherheit der Brüder und Schwestern gewirkt hatte, wäre er frei von Tätigkeit gewesen und hätte sich seiner eigenen Vorbereitung für die große himmlische Reise widmen können. Aber ein Pferd mit einem Pfeil im Schenkel kann nicht grasen, und ein Wind, der gegen den Bannerpfahl rennt, schweigt nicht. Es gab Abende für Wang in diesem Sommer, wo er in einer verlässigen Teestube sitzend, auf dem Wege durch einen Wald, von dem Gedanken an Ma-noh überfallen wurde und von diesem Gedanken niedergekrampft wurde. Eines Tages überwand er sich und schickte einen Boten, einen raschen jungen Mann mit einem Brief an Ma-noh, in dem er ihn bat, ihre Begegnung zu vergessen und ihm die Seelen wieder herauszugeben, die jetzt berauscht wären, und selbst mit ihnen zu ihm zu kommen. Nicht einmal der Bote kehrte wieder.
Es geschah, wie Ma-noh gesagt hatte: nie war unter den Brüdern und Schwestern die Inbrunst der Andacht, Weichheit des Gefühls, die Süßigkeit der Lebensempfindung größer, als seit dem Morgen, wo man sich laut zur Gebrochenen Melone bekannte. Nach ein paar Monaten weilte niemand mehr von ihnen auf dieser Seite des Daseins; in den Landschaften, die sie durchzogen hatten, ging noch das leise Gerede von ihnen und daß über ihnen das höchste Glück gestanden hätte.
Als die Gebrochene Melone noch nicht die Abhänge des Tai-han-schans nördlich Schun-tös erreicht hatte, griff eine Räuberhorde den endlosen Zug der Brüder und Schwestern an. Sie wanderten eines regnerischen Nachmittags über die monotone Lößlandschaft. Der Troß schleppte Karren, breite Wagen; über diese fielen die bewaffneten Strolche, an der Zahl achtzig, her in der Meinung, Beute zu machen. Als sie nur Bretter, wenig Reis, Bohnen und Wasser fanden, dazu eine nicht kleine Anzahl von Kranken, warfen sie die Wagen um, verunreinigten die Wassertonnen, nahmen die Säcke mit Lebensmitteln an sich. Die meisten Brüder des Nachtrabs waren geflohen; sechs beherztere, die sich der Kranken annehmen wollten, wurden mit Fußstößen und flachen Säbelhieben verjagt. Einem, der auf die Verbrecher einzureden versuchte, wurde unter allgemeinem Gelächter die Zunge abgeschnitten und an die Stirn gebunden. Die Räuber, die jetzt merkten, mit wem sie es zu tun hatten, machten eine lustige Hetze auf einige Schwestern. Unter dem brüllenden Gesang eines frommen Liedes, das eine Schwester in ihrer Todesangst angestimmt hatte, als man sie auf den Boden warf, zogen sie mit elf entkleideten gefesselten Mädchen ab.
Die Bündler schoben sich inzwischen nach vorn um Ma-noh und die Älteren. Hier verdichtete sich der Wirrwarr von Aufschreien, von ratlosen Grimassen, von einknickenden Knien. Sie suchten die Gruppe der Führer von rückwärts zu umfassen und zum Stehen zu bringen. Die schälten sich heraus, streiften mit Gewalt die Arme zurück, die sich ihnen vorstreckten, schüttelten die Köpfe, drangen weiter, indem sie die Berührungen von ihren Schultern und Rücken abstrichen.
Was wollten die Brüder und Schwestern! Ob sie nicht wüßten, wie die kostbare Lehre ihres Bundes hieße! Nicht widerstreben! Ob sie das nicht wüßten?
Auf die Kalkweißen sauste erst jetzt die Furchtbarkeit, das grausig Einsame ihrer Lehre nieder. Sie flatterten umeinander, rissen ihre krampfenden Blicke von dem Nachtrab ab, zwangen ihre Füße auf die Spuren Ma-nohs. Sie kehlten, sich windend unter den Schreien, ein überschlagendes Lied, nur für ihre eigenen Ohren bestimmt. Sie riefen heimische Geister an, trösteten einander.
Ma-noh wanderte langsam mit den Älteren unter dem tropfenden Regen. Die Älteren rangen flüsternd die Hände, warfen sich Blicke zu, blieben stehen, wünschend, daß sie der Erdboden verschlinge. Ma riß die Augen auf; ein starrer Wutausbruch. Warum sie nicht zu Dolchen und Messern griffen? Der Unterschied zwischen diesem Leiden und jedem anderen, worin liege er? Der Unterschied, worin er liege? Ja, man müsse sich zwingen, dies gut zu finden, ja sehr gut, dies anzubeten, denn dies sei das Schicksal. Genau dies sei es.
Und er zwang sie und sich, umzukehren, über die Lößlandschaft weg die Gewalttaten der Räuber an den Brüdern und Schwestern zu betrachten und dies Gift zu schlucken. Den Brüdern verwies er das freche dumme Singen. Sie warfen sich an den nassen Boden, lauschten zerschnitten herüber. Die Bündler scharten sich um die feierlich kniende qualheischende Gruppe der Führer.
Atemlose Stille. Offene Bühne. Kreischen der gebundenen Schwestern, Entblößen der zarten Leiber, knallende Stockschläge auf die Köpfe der Brüder, Gebrüll, trappelnde Pferde, unsicheres Wimmern der Kranken, leere Ebene, Regen.
Um die Wagentrümmer ballte sich alles. Als die wassertriefenden Kranken zu jammern begannen, konnten sich die Brüder nicht in die Gesichter sehen. Als der Verstümmelte röchelte und sein blutender Mund klaffte, wandten sie sich ab.
Bei der Besprechung abends in der Nähe eines Marktfleckens blieb Ma-noh unerschüttert. Man redete nicht viel. Stöhnend, mit schmerzstrengen Mienen trennte man sich. Dumpfe gärende Unruhe bei den Brüdern und Schwestern.
Fünfzig Brüder taten sich in der Nacht zusammen, forschten in dem Marktflecken nach den Räubern. Sie stellten fest, daß diese Räuber in einem Dörfchen, weit nach rückwärts von dem Flecken gelegen, hausten, daß es Behörden wie Privatpersonen bislang nicht möglich war, das Nest auszuheben. Man erfuhr auch von Landbewohnern, daß drei der geraubten Mädchen sofort nach Schun-tö verschleppt seien, acht im Dorf festgehalten würden.
Die Brüder drangen in der Nacht darauf in die ihnen bezeichneten Häuser des Dorfes, schlugen sich mit den Verbrechern herum, die einen militärischen Angriff vermuteten und sich bemühten zu entwischen. Die Schwestern wurden wiedergefunden und befreit, zwei Verbrecher und drei Brüder blieben tot im Dorf liegen auf der mondbeleuchteten Straße.
Die Verwegenheit der Brüder wuchs so sehr, daß sie noch am nächsten Tage in der Stadt den Aufenthalt der Mädchen auskundschafteten, welche in einem obskuren Freudenhause wohnten. Sie besuchten abends in Gruppen zu dreien und fünfen das Haus, hielten sich bis zur dritten Nachtwache auf, erbrachen dann ohne Schwierigkeit die Türen, versteckten sich einen ganzen Tag bei den Bettlern in der Stadt, gelangten nach einer Woche auf großen Umwegen zu dem Halteplatz Ma-nohs an den blühenden Abhängen des Tai-hans.
Ma-noh, unterrichtet von dem Vorgefallenen, trug sich damit, sie auszustoßen. Es war inzwischen schon die Mehrzahl der Bündler zu der Auffassung bekehrt, daß das Wu-wei Mittelpunkt und Rettung sei, Mittelpunkt und Rettung bleiben müsse. Die Befreier kamen beschämt. Wo die Trauer aufrichtig schien, verzieh Ma. Fünf, die sich einsichtslos rühmten, wurden verstoßen.
Es entspann sich ein erbitterter heimlicher Kampf zwischen Ma-noh und den Widersachern im Bund. Der bald zutage tretende Sieg Mas zeigte die ungeheure Gewalt, über die der völlig umgewandelte Mann verfügte.
In der fruchtbaren dichtbevölkerten Gegend am Fuße des Tai-hans entwickelte sich aus dem Schoß des Bundes die heilige Prostitution.
Die Schwestern hatten sich schon nach dem Aufenthalt am Sumpfe von Ta-lou gewöhnt, sobald sich ihnen auf der Wanderschaft, in einsamer Gegend, Bergstraße, Wald, Männer näherten, zu ihnen heranzugehen, mit ihnen freundliche Worte zu wechseln; auch Liebkosungen konnten sie sich nicht entziehen, ohne Gefahr zu laufen. Diese Gepflogenheit wurde nach dem Überfall vor dem Tai-han-schan allgemein.
Die Schwestern rüsteten sich, einen Wall von Sanftheit um die Gebrochene Melone aufzuwerfen. Sie gingen nicht in dem lumpigen Bettlerinnenzeug, suchten sich mit Hilfe der Brüder bunte Kleider zu beschaffen, schön bemalte Schirme, feine Haarkämme. Alle Tage fanden sie sich abends zusammen, und die kundigen lehrten sie die entzückenden Liebeslieder der bunten Quartiere singen, die Pipa zupfen. Wo die Arbeiter am Wege standen und die kaiserlichen Straßen ausbesserten, an den Erdnußsuchern, die im Acker wühlten, wichen sie nicht mehr ängstlich vorüber; sie kämpften mit den Frauenwaffen, glitten vorbei. Es waren unter den bald fünfhundert Frauen an zehn, die die Situation des Bundes Ma-nohs durchschauten, ihr Schicksal an die Gebrochene Melone knüpften, mit Klugheit und Entschlossenheit zur Festigung des Bundes beitrugen. Die jüngeren Schönen bildeten die heilige Prostitution. Es würde sie niemand, so sagten sie, hindern, den ebenen Weg zum Westlichen Paradiese einzuschlagen, jetzt, wo sie alles, alles mit jedem teilten.
Es geschah etwas Befremdliches am Tai-han-schan, etwas Märchenhaftes, Naives, von der Art eines Liedes. Die Bettlerhütten waren aufgeschlagen, die Männer gingen in die Berge hinein, wo Ansiedlung an Ansiedlung stieß. Die Mädchen liefen umschlungen über die schachbrettartig geteilten Felder. Auf den schmalen Pfaden zwischen den Reis- und Weizenfeldern zerstreuten sie sich. Der fauligweiche Boden dellte sich unter den leichten Füßen der Glückbringerinnen. Zwischen dem Grün der Halme blitzte grelles Rot, auf kindshohem Stengel eine straffgewölbte Blüte, seidenglänzendes Purpur: der Mohn. Die Ponys der Mädchen klebten fest an den niedrigen Stirnen. An bunten Gürteln trugen sie Almosenschalen. Diese und jene, nicht gewöhnt zu gehen, bewegte einen Stab mit Messingbehang, den Rasselstab in der Hand.
Wenn eine Glückbringerin eine arbeitende Frau oder ein Mädchen traf, so grüßte die geschmückte Bettlerin sie, nannte sich beim Namen, sagte, daß sie zu dem Bund der Gebrochenen Melone gehöre, erzählte, nahm teil, schenkte, wenn sie sich verabschiedete, ein kleines Tuchsäckchen mit Asche oder ein Papieramulett mit Charakteren.
Ein Arbeiter fragte sie nach der Gegend, nach Richtung der Geisterpulse des Bodens; sie ließ sich beschenken von dem ehrerbietigen, setzte sich mit ihm hin an einen Feldrain, unter einen Sophorenbaum, aß, was er ihr gab, und während er ihr entzückt zusah, erzählte sie von den wunderwirkenden frommen Männern, denen sie zugesellt sei, von dem schweren Schicksal, das sie erlitten habe. Und damit trippelte sie davon, indem sie sich oft umwandte und zum Gruß verneigte. Wen die heilige Prostituierte neben sich zittern und ängstlich blicken sah, tröstete sie, indem sie sich entfernt von ihm setzte und ein paar kleine fremde Lieder sang. Sie lüftete am Halse ihren losen Kittel, zog ein rotes Tuch heraus, band es sich um das Gesicht. Hinter dem Tuch klang ihr Lachen, und so gönnte sie dem Beglückten alles, was er wünschte. Kam wieder den Weg, bis sie aus der Gegend verschwand.
Rasch flog das Gerücht von dem neuen Bunde in die Städte, die bunten Quartiere, in die Theater, die Teehäuser. Sklaven und Sklavinnen, Schauspielknaben und bemalte Damen entwichen. Vergebens taten sich die Besitzer der Häuser zu Verbänden zusammen, appellierten an die Behörden, verweigerten Konzessionsgebühren, um einen Druck zu üben.
In aller Munde war die Geschichte des jungen Fräuleins Tsai aus Tschian-ling und wie sie entfloh. Sie war ganz jung verkauft worden an ein wenig renommiertes Haus.
Als sie den Restaurationsbetrieb geleitet hatte im Innern des Hauses und infolge des unausgesetzten Genusses von heißem Wein magenleidend geworden war, — ein Wein, der mit den liebeanregenden Zusätzen gewürzt wurde —, überlegte sie in einem nüchternen Augenblick, ob es nicht besser wäre, zu hungern und zu frieren, als dauernd zu erbrechen, sich schlagen zu lassen von der Besitzerin und an Lastenträgern, Ölhändlern, Schiffziehern Liebeshandlungen zu verrichten.
Da sie in keiner Weise geschont wurde und sich völlig ruiniert fühlte, sprang sie aus ihrer offenen Sänfte, deren Träger sie reich bestochen hatte, in das Magistratsjamen, wurde sogleich verhaftet, nach Aburteilung ihrer viehischen Wirtin in das Rettungshaus gebracht, welches die Stadt neben dem Gefängnis unterhielt. Sie lernte in den kurzen Wochen ihres Aufenthalts dort nützliche Dinge, man hängte ihr Bild in den Glaskasten an dem Eingang des Hauses für Männer, die sich hier eine Frau suchten.
Sobald nun ihr Bild ausgehängt und allen sichtbar war, berichtete dies ein Bote der bestraften Wirtin, welche sich noch nicht von ihren hundert Bambusschlägen erholt hatte; die Frau veranlaßte einen Neffen von sich, einen Herumlungerer, den sie aushielt, sich an den Direktor des städtischen Rettungsheims zu wenden, ihm erlogene Garantien für seine Person zu geben und das Mädchen zur Frau zu verlangen. Nachdem der Bursche sich noch heuchlerisch nach den guten Eigenschaften seiner zukünftigen Braut erkundigt hatte, erklärte er, sie zu heiraten, holte sie in eine gemietete Wohnung für ein paar Wochen ab und brachte sie dann seiner Tante zurück.
Das unglückliche Mädchen zerquälte sich den Kopf, um der Polizei den Betrug zu melden; man kam ihr auf die Schliche, nahm ihr jegliches Geld weg, sperrte sie ein, täglich schlug sie die Frau, bis sie nachgab und versprach sich zu fügen. Wieder fing das zerrüttende Trinken an; mit blutunterlaufenen Augen ging das Mädchen herum, völlig matt, sich tief verneigend, wo sie immer die Wirtin sah, froh, daß man ihre Hände und Fußsohlen ausheilen ließ.
Dann erzählte ihr eines Tages ein frisch angekommenes Mitglied des Hauses, der dieses Leben nicht gefiel, daß sie einen Melonenkernverkäufer kennen gelernt habe, der sich in sie verliebt hätte und ihr helfen wolle. Das vielgehetzte Mädchen wurde halb widerwillig verleitet; sie setzten gemeinsam mit drei andern Insassen des Hauses, die man ins Vertrauen gezogen hatte, eine lange Klageschrift gegen die Wirtin und den Neffen auf; die Novize übernahm es, das Blatt ihrem Verehrer zu übergeben; er sollte es den ordnungsmäßigen Weg an die Behörde leiten. Der Melonenkernverkäufer brachte auch den Brief an die richtige Stelle; aber ehe Beamte ins Haus kamen zur Untersuchung der Angelegenheit, hatte der Neffe durch einen untergeordneten Diener des Jamens, der die Schreibstuben ordnete, Kenntnis von der Beschwerde erhalten.
Die Mädchen hörten ängstlich eines Abends durch den Fußboden seine erregte Debatte mit der Wirtin im Empfangssalon unten, wegen der Maßnahmen, die man treffen sollte. Da griffen die fünf kompromittierten gefährdeten Geschöpfe zu einem Gewaltmittel; sie banden die Frau, welche auf dem Korridor die Aufsicht ihrer Zimmer führte, nachdem sie ihr mit Papier den Mund verstopft hatten; ließen sich an falschen Zöpfen und ihren eigenen, die sie rasch abschnitten und schnürten, an der Hinterseite des Hauses herunter, liefen Hals über Kopf durch die Straßen, versteckten sich bis zum Morgen hinter der Stadtmauer und schlüpften, nachdem sie ihre eleganten Kostüme gegen die Lumpen von Bettlerfrauen eingetauscht hatten, welche an den Mauern in überdeckten Erdlöchern übernachteten, aus dem Tor eine nach der andern hinaus.
Sie hätten es nicht nötig gehabt, sich zu überstürzen, denn die Wirtin und ihr Neffe waren nach dem ersten Schreck froh, daß die fünf Anklägerinnen verschwunden waren, und schickten ihnen jeden Segenswunsch auf den Weg. Aber den fünf Mädchen peitschte die Todesangst den Rücken; sie liefen gedankenlos Li um Li; warfen sich bei jedem Lärm von rückwärts lang auf den Boden; schließlich, als sie einen Berg erklommen hatten und auf einem unbetretenen Steinacker saßen, weinten sie sich zusammen ruhig.
Der weitere Verlauf dieser recht gewöhnlichen Angelegenheit ließ an Banalität nicht zu wünschen übrig. Am Ende des ersten Tages trennten sich zwei von den Mädchen ab, die vor Aufregung, Hunger und Furcht nicht weiterkonnten, und blieben auf dem Magistrat des Dörfchens, das sie erreichten, mehrere Tage, wartend, daß die benachrichtigte Wirtin sie wieder holen sollte. Diese aber beschuldigte die Mädchen des Diebstahls und der Verleumdung. Der sehr gutmütige Bürgermeister hielt ihnen nach ein paar weiteren Tagen im Dörfchen dies vor und empfahl ihnen, lieber keinen Wert darauf zu legen, in die Stadt zurückzukehren, weil sie ja tatsächlich Kleidungsstücke entwendet hatten. Und so arbeiteten die verwöhnten Kinder um kargen Lohn draußen auf den Äckern und in Ställen, verwünschten die ganze Sache.
Die drei anderen Mädchen erreichten Ma-nohs Truppe nach fünf Tagen, welche sie auf den Tod erschöpfen ließen, nach ununterbrochenem Wandern, Frieren, Dursten. Man nahm sich ihrer sehr an. Aber zweien von ihnen behagte bald das strenge stille Leben nicht. Man beachtete ihre Fähigkeiten und Schönheit nicht genug. Die Gedankengänge unter den Schwestern und Brüdern schienen ihnen langweilig, auch komisch. Die eine heiratete einen Bruder, dem es ging wie ihr. Die andere, eine geschickte junge Person, ließ sich von einem entlaufenen kaiserlichen Schauspieler ein paar der bei Hofe beliebten Tänze einstudieren, lernte ihm Phrasen und höfische Interna ab und wurde rasch als bedeutende Acquisition von dem Besitzer eines Teehauses mit Varietee engagiert. Er ließ reklamehaft ausstreuen von Intrigen, denen sie am Kaiserhofe erlegen sei und so weiter.
Nur die Blutarme, Gehetzte, die sich halb willenlos hatte mitziehen lassen, blühte auf unter den Gebrochenen Melonen. Sie hätte dieses Glück nicht für möglich gehalten. Zum ersten Male strahlte wieder etwas wie Hoffnung aus ihren eingesunkenen Augen. Aber sie war diesem Leben am wenigsten gewachsen. Ein fliegender Shi, wie sich die Kundigen der Bündler ausdrückten, bohrte sich durch ihre Haut und Eingeweide. Sie erbrach Blut und konnte nicht weiter. Man beschaffte für sie aus einer Dorfapotheke die lebenerneuernden Pillen aus dem Mutterkuchen einer erstgebärenden Hündin. Aber im schönen sommerlichen Feld blieb sie tot liegen und war ihr jämmerliches Dasein los.
Der Ruf der heiligen Prostitution verbreitete sich weit in diesen Landschaften. Vielleicht trug nichts so dazu bei, die Sekte bekannt zu machen. Die Behörden und die hetzenden Literaten in den Kung-tse-tempeln, durch nichts gehemmt, konnten doch zu keinem Entschlusse kommen über die Maßnahmen. Man konnte nicht die vielen hundert, zu denen entartete Angehörige der ältesten Familien gehörten, durch Polizei und Provinzialtruppen niedermetzeln lassen; das Schauspiel der Abschlachtung von Wahnwitzigen, die sich mit keiner Handbewegung wehren würden, wagte man nicht.
Man suchte durch Milde und sanfte Gewalt die Bündler zu bewegen, sich zu zerstreuen. Als jedem Versuch ein rundes Nein entgegengestellt wurde, verboten die Präfekten allen Ortschaften und Ansiedlungen, denen sich die Bündler näherten, die Gewährung von Speise und Trank an sie. Einzelne Präfekten arrangierten auf eigene Faust, unterstützt von ihren Behörden, Unternehmungen gegen die Bündler. Sie bedienten sich des Aberglaubens der Bevölkerung; streuten Gerüchte aus, daß die Bündler schöne Frauen aus einzelnen Dörfern mit Gewalt entführten, daß sie im Besitz lebenverlängernder Pulver seien, die sie für sich behielten. Auf Grund solcher Gerüchte erfolgten kleine Überfälle auf Bündler, die sich eben von dem Lagerplatz entfernt hatten. Man zog sie nackt aus, verbeulte sie. Die geheimen Veranstalter hofften durch solche Angriffe den Zulauf zum Bund zu mindern und über die Bündler Angst zu werfen. Unvermindert blieb die Ruhe der Gebrochenen Melonen, unverändert wirkte die Suggestivkraft des Westlichen Paradieses, das sie dem verhießen, der ohne Unruhe und von keinerlei Begierde getrübt dem Tao folgte; nur sie wüßten das reine echte Tao, und sie würden sich jener Kräfte bemächtigen können, von denen die alten Lieder singen.
Als solche Angriffe auf die Bündler wenig Erfolg hatten, zogen sich die Präfekturen von der Angelegenheit zurück, erstatteten den Provinzialbehörden Berichte, warteten ab.
Eifrig wurde in den Kung-tse-tempeln geschürt. Die Literaten, ehemaligen Regierungsbeamten, die zur Disposition Gestellten, ihre Freunde, alles Offizielle im westlichen Tschi-li betrachtete die Gebrochenen Melonen als persönliche Feinde, die man um so heftiger bekämpfen mußte, als der Regierung offenbar noch die Hände gebunden waren. Hier hatte man nur Furcht vor dem schlimmen Eindruck einer Niedermetzelung auf das Volk, sonst wäre längst alles erfolgt.
Bis eines Tages ein alter Militär, vom Rang eines Ti-tu in Schun-tö, dem religiöse Streitigkeiten zuwider waren und der sich nach Pe-king beliebt machen wollte, vorschlug, er wolle die Vernichtung der Gebrochenen Melone übernehmen auf eigene Verantwortung, wenn man ihm eine größere Geldsumme zur Einstellung einer Anzahl ehemaliger Soldaten, wahrhafter Vaterlandsfreunde, zur Verfügung stellte. Die Summe durch rasche Subskription der erfreuten Verschwörer zusammengebracht, machten sich eines Nachts zweihundert Mann von Schun-tö auf, um noch vor Morgen im raschen Marsch die Bündler zu erreichen, ehe sie ihr Lager verließen; der Ti-tu unter ihnen. Am frühen Morgen kam es dann zu dem berüchtigten Blutbad bei einem Dorf, nächst dem sich das Lager der Gebrochenen Melonen befand.
Das Gerücht von der Ankunft einer bewaffneten Bande hatte schon tagelang vorher die Bewohner dieser Gegend alarmiert; man zweifelte an der Möglichkeit eines Vorgehens gegen die harmlosen Menschen. Immerhin hatte das Auftreten des Bundes und die heilige Prostitution bereits hinreichend gewirkt, um eine große Anzahl von Bauern in der Morgenfrühe dieses Tages auf die Beine zu bringen. Sie liefen in Haufen von allen Seiten an, als Wehegeschrei aus dem friedlichen Lager scholl. Am Eindringen wurden sie durch flüchtige Brüder und Schwestern gehindert. Dann Keule gegen Keule. Sensen rissen schwertschwingende Hände weg. Spitze Bambuslanzen bohrten sich durch anrennende Leiber. Über Rücken meuchelnder Soldaten wuchteten Balken und Wurzelkloben. Maulaufreißen, Ächzen, Dumpfen, Knallen. Schweißdampf, dünne Blutsäulen, unregelmäßiger Rhythmus von Stille und Gebrüll. „Kuan-yin hilf! “ Nach einer halben Stunde war der Dämon des Orts gesättigt. Hundert Soldaten blieben liegen, über zweihundert Schwestern und Brüder, vierzig Bauern.
Die Bündler sammelten sich. Rasende Flucht entfernte sie von dem Platz.
Gegen Abend erreichten sie in nördlicher Richtung einen großen See, den die Anwohner See der Eintracht nannten, hielten, entsetzt, daß man die Einsargung und Beerdigung der Toten den Bauern hatte überlassen müssen. Ma besänftigte. Er habe schon auf dem Wege von einer wissenden Stelle die Äußerung empfangen, daß die toten Schwestern und Brüder wohlvorbereitet gestorben seien; ihre Geister schwebten nach den erstrebten Bezirken auf.
Am mondhellen See beriet er mit acht Brüdern, was geschehen solle. Man konnte sich nicht hinmorden lassen. Mit gemachter Entschiedenheit erwiderte Ma, es sei gleich, an welchem Tage man sterbe; es käme nur auf die Bereitschaft des Geistes an. Er redete flau und fühlte, daß er nicht das Richtige für die ungeheure Lage traf. Er konnte nichts erwidern auf die Frage, ob man nicht sehen müsse, sich gut vorzubereiten, statt in den Tod zu rasen.
Hunderte über hunderte rotteten sich zusammen unter dem Banner der Gebrochenen Melone; aber keine Überfahrt in die ersehnte Heimat bereitete man ihnen, keinen Hafen für die Verdorbenen und Verunglückten. Nicht anders als Betrug konnte man es nennen, Schändung ohne Gewissen. Zur Schlachtbank führte man sie, zur Schlachtbank und nicht zum Westlichen Paradies.
Zu der Musik der scharrenden Schilfrohre flüsterten sie. Ma-nohs trostloser heißer Blick haftete fast irre an der großen Klosteranlage auf der anderen Seite des Wassers. Er konnte in der Helligkeit des Himmels alle Einzelbauten der Lamaserie erkennen, die vielen Kapellen, die große breite Gebethalle, die Wohnhallen der Mönche. In solchem stillen Hause wohnte er lange Jahre. Jetzt lag er ausgestoßen mit vielen hundert Menschen wieder vor seinen Toren. Durch einen See getrennt.
Die Brüder würgten sich verzweifelte Entschlüsse ab. Der Bund sollte aufgelöst werden. Die grauenhafte Verantwortung wollte keiner tragen. Sie flehten Ma an: „Was tun, was tun? “ Morgen, übermorgen, in einer Woche kommen die Provinzialtruppen, umstellen die Gebrochene Melone, zerschmettern Brüder und Schwestern. Kein Zweifel; noch heute Bericht von Ortsbehörden an Präfektur, Tsong-tou; Friedensbruch in der Provinz; baldiger Eingriff der Regierung. Was hat die Gebrochene Melone verschuldet, daß das geschah? Alles Klagen hilft nichts. Was soll geschehen? Die teuren Brüder tot, die feinen Schwestern, die frommen Wanderinnen tot. Blutsäulen, zerspaltene Stirnen, willig hingehaltene Hälse: unausdenkbar das alles, überqualvoll, zermalmend, zwischen saurem Schweißdampf und hetzendem Gröhlen Aufstieg in die Westlichen Bezirke. Der Bund, der Ring zerbrach.
Ma-noh saß still, horchte auf sich. Er erinnerte sich auf einmal jener ersten Unterredung der Nan-ku-Bettler mit Wang-lun in seiner Hütte. Man drängte Wang um Schutz von der Weißen Wasserlilie. Für die Gebrochene Melone gab es keinen Schutz, sie war ohne Freunde, Wang-lun hatte sich erhoben mit seinem langen Schlachtschwert, in der Nacht das Lager seiner ehemaligen Brüder verlassen.
Ein siedender Haß auf Wang-lun übergoß Ma. Sein Arm wurde von innen geschüttelt, seine Zähne geknirscht. Ein Entschluß stürmte durch seine Knie in seine Zehen, rüttelte an seinem Zwerchfell, so daß sein Atem still stand; wie von Blitz und Donnerschlag war er widerhallend durchrollt.
Die schmalen bunten Gebetswimpel auf den platten Dächern drüben schaukelten im Wind, stellten sich auf.
In stummer Frühe ließ Ma den Lagernden ein Zeichen geben. Man rauschte um den See. Rasch waren die Klosteranlagen von den Menschen umfaßt, bevor die drei ersten Stöße des Muschelhorns die Brüder drin zur Frühandacht weckten.
Ma schlug mit der Faust an das Tor. Fünf seiner Brüder folgten ihm über den Hof in das hochgelegene Zimmer des Chan-pos. In dem kahlen hohen Zimmer, in das ein paar Stufen vor einen verhängten Raum herunterführten, stand der Chan-po vor einem prachtvoll geschnitzten Wandtisch, der die Bilder Verehrungswürdiger trug; ein noch junger Mensch mit ruhigen geistvollen Zügen. Ma-noh in seinem Flickkleid hatte sich nicht von dem Pförtner abweisen lassen; der Prior wartete zu hören, was so dränge. Er schien nicht gewillt, die sechs Fremden ohne weiteres als Gäste zu betrachten; nach der Begrüßung schwieg er.
Ma nannte seinen Namen und die der Begleiter, erklärte mit kalter Beherrschtheit, daß er mit dem Prior über eine wichtige Angelegenheit verhandeln wolle.
Der entgegnete, daß die Almosenverteilung Sache eines Bruders sei, zu dem sie der Pförtner führen würde; der würde sie auch über ärztliche Hilfeleistungen und Stillung augenblicklicher Not beraten.
Ma-noh wollte den Chan-po sprechen.
Er lud sie zögernd zum Sitzen auf den Kniehockern ein, mit dem Hinweis, daß die Frühmesse bald beginne.
Ma-noh, hinkauernd, erklärte, daß ihre Zeit sich auf die Zeit zwischen zwei Atemzügen beschränkte und sie bald zu Ende sein würden. Ob der gründliche Kenner der heiligen Saktastexte aus den Göttergesprächen magische Formeln gelernt habe, mit denen man Menschen vor der völligen körperlichen Vernichtung retten könne.
Der Prior staunte den kenntnisreichen Bettler an und sagte langsam, er wüßte einige schützende Silben, indem er seine gelben Augen auf den Mann richtete.
Ob, fragte Ma weiter, der wissende Prior den schützenden Silben so vertraue, daß er sich selbst mit ihnen in Gefahr begeben würde.
Der Chan-po, tiefer erstaunend, erklärte, er vertraue diesen Silben und manchen anderen; aber ob der Frager vielleicht ein verkleideter Ge-long sei, wozu er ihn aufsuche und examiniere; was dies bedeute und wer sie wären.
Ma-noh, mit ihm zusammen aufstehend, meinte, es sei kein Anlaß, die Unterhaltung, die eben beginne, bald am Ziel sei, schon abzubrechen; und eine verlorene Frühmesse wiege für die Heiligkeit nicht so viel wie der Mord an tausend Männern und Frauen. Denn sie könnten ohne Umschweif und Höflichkeit verhandeln; ob der erleuchtete Chan-po mit seinen fünfhundert Mönchen gleich in die Ebene hinuntergehen würden, von Verbrechern verfolgt, aber vertrauend auf die Tantrasformel? Ob der erleuchtete Chan-po sich herablassen würde, einen Blick zum geöffneten Fenster hinauszuwerfen und zu sehen, was die Nacht draußen verändert hätte. Der Abt mit zwei Schritten gegen das Fenster, riß es auf; Murmeln der Mönche über den Hof, das schimmernde Seeufer, soweit man sehen konnte in dem Morgennebel, geschwärzt, eingefaßt von hunderten sich regenden Menschen, Männern und Frauen, Wagen, Karren; sie hielten sich so still, daß nicht einmal die Mönche draußen, die zur Messe gingen, etwas ahnten.
Das Gesicht des Abtes, viereckig, gefroren, wandte sich nicht um; er gurgelte: „Sind das die Verbrecher, die uns verfolgen? “
Ma-noh, neben ihn tretend, schloß vor seinem Gesicht rasch das Fenster; dies seien die Verfolgten, die von ihm Schutz verlangten. Aber niemand könne freilich sicher sagen, wann aus Verfolgten Verfolger und Verbrecher würden. Sie seien die Gebrochenen Melonen; ein unkeuscher Name für das keuscheste Ding; sie seien heute morgen massakriert worden; ihre Toten lägen noch einen Tagesmarsch hinter ihnen auf dem freien Felde; jetzt verlange er, Ma-noh, für seine gehetzten Menschen Wohnung, Mauer und Schutz.
Es klopfte gegen die Tür; der Abt drehte den Kopf. Er könne nicht kommen zur Andacht; man möchte ihn vertreten; man möchte nicht zu langsam lesen und bald den vertretenden Bruder Ge-long zu ihm heraufschicken.
„Was, mit geraden Worten, Bruder Ma-noh, willst du von mir? “
„Du sollst uns aufnehmen in dein Kloster, Männer und Frauen, und dann die Tore verschließen, großer Chan-po. “
„Wie kann ich euch schützen? Ist der Schutz von verfolgten Heeren Sache der Klöster? Wer im Freien steht und den Blitz auf sich zieht, warum schilt der auf den Blitzschlag? “
„Niemand schilt. Wir brauchen keine Belehrung. Wir brauchen Schutz. Wenn der große Chan-po mit seinen Mönchen nicht Platz genug für uns im Kloster hat, so wird der große Chan-po mit seinen Mönchen das Kloster verlassen müssen. Auf ein paar Wochen. Bis es besser für uns geworden ist. Hier gibt es keine Wahl für uns Gehetzten. Dies ist die gerade Antwort. Und auch für den Chan-po gibt es keine Wahl; wenn er nicht in zwei Tagen mit unserem Blut befleckt dastehen will und seinen schrecklichen Wiedergeburten nachweinen wird. Auf seinen Schultern die Last von hundert unbefreiten Menschen. “
Ma-noh wartete mit den fünf Brüdern in einem Zimmer des Erdgeschosses; sie tranken seit langer Zeit wieder den feinen heißen Tee aus bemalten Tassen. Die Stimmen des Abtes und seines Stellvertreters klangen abgerissen herunter. Nach einstündiger Beratung ließ der Abt sie wieder rufen. Er hielt mit erblichenem Gesicht noch das schmuckreiche schwarze Gebetszepter in der Hand; neben ihm stand sein Stellvertreter, ein scharfer grauer Kopf mit mongolischen Zügen. Eindringlich sanft bat der Abt Ma-noh, das Kloster mit allen Schätzen gut zu verwahren; er möchte ihm Boten schicken in das kleine Kloster jenseits des Flusses, wohin er selbst zöge, und ihm mitteilen, wann die Gefahr für sie vorüber sei und sie das Kloster verließen. Beim Amithaba habe er gebetet, daß die Seelen der unglücklichen Verfolgten gerettet würden.
Ma ging mit straffen Schenkeln über den Hof, der von aufgeregten Mönchen wimmelte. Die Tore öffneten sich; man umringte ihn draußen. Dann erhob sich das Jauchzen, das sich lauffeuerartig fortpflanzte.
Als die heiße Sonne eben im Mittag stand, schoben sich die mächtigen Torflügel auf. Man sah aus vielen Höfen die Mönche zusammenströmen, sich hintereinander ordnen, sich um liegende Geräte mühen. Der Auszug des Chan-po mit der gesamten Mönchsschaft vollzog sich. Die Menschenmassen vor dem Tore teilten sich.
Die Geistlichkeit, das allerhöchste Gut der Welt, erschien inmitten der Armen, die einen dilettantischen, viel kürzeren, schmerzensreichen Weg nach den ewigen Freudenhimmeln einschlugen. Voran junge Novizen mit leeren Händen, unbedeckten Köpfen; die Ban-dis, kahle runde Schädel mit einem kleinen Haarbüschel auf dem Scheitel.
Zu fünf nebeneinander Mönche mit langen braunen Kutten bis zu den Füßen; viele hatten die rote Priesterbinde von der linken Schulter zur rechten Hüfte umgeschlungen; manche trugen Überwürfe, weite gelbe Mäntel, die die rechte Schulter nackt ließen. Alle unter schwarzen vierzipfligen Mützen. Murmelton. Zu zweit trugen sie rote Paniere mit andachtgebietenden Inschriften. In Sänften zuletzt die Priester aller Weihen, unter ihnen in einer gelb ausgeschlagenen Sänfte der Chan-po. Zwischen den höchsten Priestern Lehrlinge mit Polstern in den Händen, darauf die Altarstücke und die sieben Kleinodien, kunstreich geschnitzte, gegossene Tiere; Elefant, Goldfisch, Pferd, Opferschalen aus Silber, gebuckelte Teller, Gießkannen, Metallspiegel, heilige Symbole der fünf Sinne. Auf bedeckten Karren fuhr man fort das umfassende Buch, die Mutter genannt, zwölf schwere Bände in holzgerahmten Seiten. Vor, neben der Sänfte des Chan-po krachten Mönche von Zeit zu Zeit in die Gongs, pumpten ihre Lungen in die ungeheuren Posaunen, die auf den Schultern der Vorangehenden ruhten.
Auf breiten Bahren schwankten die Bildsäulen der großen Götter vorüber; unverhüllt blickten die wesenlosen Gesichter über die erregten Menschen, ertrugen den frischen Duft des Sees. Da saß der Beryllglanzkönig auf dem Lotosthrone; in der herabhängenden Rechten hielt er die mystische goldfarbige Myrobalane; die beiden Buddhas mit der Löwenstimme und der Kostbaren Kopfzier begleiteten ihn. Das furchtbare Bild der Heilspendenden Göttin, die auf einem Blutmeer reitet, tauchte aus dem Dunkel ihrer Kapelle in die warme helle Himmelsluft hinein; ihre blitzschießenden drei Augen, ihre brennenden Augenbrauen vermochten nichts gegen das gleichmäßig heitere Sonnenlicht, das in unverminderter Kraft über ihr schlangenbefangenes Gesicht fuhr. Zuletzt schleppte der Pförtner seinen abgestandenen, verkümmerten Leib an, gab Ma-noh, trübe Gebete keuchend, das unförmige Vorhängeschloß des Tores.
Das Blasen der Posaunen tönte noch von der rechten Seite des Sees; ab und zu puffte ein Gongschlag. Da strömte jubelnd, weinend, ernst der absurde Troß der armen Gebrochenen Melonen in die leeren Höfe, die schlammbedeckten Männer, die Verwundeten, die Blutbespritzten, die Mädchen mit den bunten Kitteln und trockenen Blumen im wirren Haar, die Sängerinnen, die vor Angst lachten, die stammelnden plappernden Blinden und Krüppel. Sie drangen in die Höfe, die Kapellen, die Gebetshallen, aus denen die überirdischen Götter ausgezogen waren, füllten jeden Winkel und jeden Raum bis zu den bemalten Decken mit ihrem Elend.
Man richtete sich in dem Kloster ein. Während die Handwerker die Höhe und Festigkeit der Ziegelmauern bewunderten, Lahme und Wundgeschlagene auf die roten Diwane in der Gebetshalle gebettet wurden, Schwestern Bohnen und Hirse aus den Vorratskammern schleppten und in den noch heißen Kesseln kochten, saßen Ma-noh und seine Vertrauten in dem Zimmer des Chan-po, sannen nach. Öfter sahen sie sich betreten an; man hatte Reichtum und Schutz; aber dies war nicht gut. Sie saßen mit feuchten Kleidern in dem gepflegten geschmückten Hause; auf Holzboden sickerten Schmutzlachen von ihren Schuhen und Kitteln. Der scharfe und muffige Dunst stieg aus den durchnäßten Stoffen, stach ihnen in die Nasen; ihre Augen tränten. In unwillkürlicher Bewegung seufzte der jüngere ernste Liu, fragte: „Wollen wir nicht hinuntergehen, auf dem Hofe für uns Zelte schlagen? “
Ma-noh ging mit ihnen; er sagte nicht „nein“, nicht „ja“. Metaphysische Gespräche schwebten in den niedrigen Holzkorridoren, die sie durchgingen. Hier war noch nie die Rede gewesen von Hunger, Totschlag; das Holz des Hauses war getränkt mit Gedanken von der Erbauung und Vernichtung der Welt. Ma-nohs Freunde spürten nichts von dieser Luft. Er schlürfte gebunden hinter ihnen her; ihn erregten diese Zimmer und Gänge, als wenn sie mit kleinen Geistern, rufenden stichelnden Geistern angefüllt wären. Teilnahmslos erledigte er Besprechungen. Aus den alten Brettern schlugen die Leute unten Hütten, Zelte auf den Höfen, um die Hallen unbewohnt zu lassen. Er ging langsam wieder auf das Zimmer des Chan-po, konnte sich nicht losreißen. Allein in dem großen leeren Hause hockte er im Zimmer des Chan-po vor dem leeren Buddhaaltare, durch die Finger zog er einen Rosenkranz, der neben einem Kniepolster lag, zählte die Perlen. Der muffige Dunst von Kleidern konnte den weichen Weihrauchgeruch nicht verdrängen. „Ma-noh, der geweihte Mönch von Pu-to-schan, sitzt wieder in einem Kloster“, sagte er sich laut vor. Er fühlte, daß er ausruhte und es für ein paar Augenblicke gut sein lassen wollte. Befleckt saß der Mönch im Kloster, und schämte sich nicht, fürchtete sich nicht. Die Schreie der Ermordeten hallten noch in seinen Ohren. Er atmete nach dem Blutbad, erinnerte sich, daß er lebte. Rosenkränze, Buddhasäulen, die kostbaren Altarstücke, die Kleinodien, sie konnten alles mitnehmen; man lebt, man atmet, findet sich zurück. Den Elefanten hatten sie getragen, die Symbole der fünf Sinne; Ma-noh verzog höhnisch sein Gesicht: dies war alles falsch, damit ist es nicht getan. Eine neue Methode, ein anderer Weg! Klingeln, räuchern, beten; sie sollten die armen Schwestern winseln hören! Sie manövrierten mit den altersgrauen Tieren, den verstiegenen Reflexionen eines fremden Landes. Alle heiligen Berge, alle massiven Klosterkomplexe standen nutzlos auf dem Boden herum; mit dem Röcheln eines Bruders konnte man sie umwerfen. Wie ehrfurchtfordernd der Chan-po eben dagestanden hatte; und jetzt trug man ihn in irgendeine kleine Kapelle und er, Ma-noh, der hergelaufene Einsiedler von Nan-ku, saß auf seinem Platze, lachte drohend die leeren Altartische an; die Götter rissen bei seiner Ankunft aus. Was sind Klöster? Orte, an denen man träumt und seinen Weg verfehlt. Nur die Mauern sind gut; die Dächer sind gut. Sie schützen gegen Regen und nächtliche Stürme; sie versperren Geistern den Weg; der Winter hockt vor der Tür.
Schutz gegen die Verbrecher. O, Klöster lohnten schon. Kein böswilliger Halunke konnte einbrechen und Spieße in fremde Rücken bohren. Wie hat man Brüder und Schwestern heute morgen hingemordet; zu Dutzenden fielen sie, so ergeben haben sie gebetet. Wenn nicht die Bauern gekommen wären, so hätten die viehischen Burschen, hinter denen ein Präfekt steckte, die ganze junge Ernte niedergetrampelt. Schufte, Schufte! Er mußte zusehen, wie man seine Leute hinschmetterte, wehrlos war er gegen die Schufte; er wollte ja wehrlos sein. Irgendwo in Nordtschi-li ging jetzt Wang-lun herum, den Gelben Springer an seiner Seite; er nahm Mord und Totschlag auf seine Seele; die Wahrhaft Schwachen dehnten sich. Nur die Gebrochenen Melonen, seine traurigen armen Schwestern und Brüder, waren heimatlos, pfadlos.
Sollte man denn sterben, sollte man wirklich die große Lehre so verstehen: das Schicksal kommt von irgendwo, man stellt sich ihm in den Weg und läßt sich köpfen? Sollte man sterben? Sollte man sterben?
Ma-noh wandte sich vom Boden ab, auf den er seinen Rumpf tief gebückt hatte; bemerkte den Rosenkranz in seiner Hand, legte ihn beiseite, rieb seine Hände, rieb seine Schläfen.
Es wäre gut zu sterben. Warum nicht? Es kam nicht darauf an zu leben, sondern gut gerüstet, mit beladenen Armen an die Pforten jenes stillen schönen Paradieses zu kommen. Jahre früher, Jahre später, das konnte nichts bessern.
War man gerüstet? Aber war man gerüstet?
Ma-nohs Hand tastete nach dem Rosenkranz. Er richtete sich hoch, ging die Stufen zu dem verhängten Schlafzimmer des Chan-po hinauf; zog den Vorhang weg, warf sich, den Rosenkranz über die Brust gelegt, auf das Bett. Das ungewohnte Klappern scholl durch das Haus; im Hof schlug man Bretter zusammen; ein tiefes Singen wie aus dem Innern einer Blechkanne surrte aus einer Halle.
Man war nicht gerüstet. Man brauchte Ruhe, Zeit, Eindringen, Vertiefung, Mauern, Mauern! Bretterschlagen nutzte nichts; damit war es nicht getan. Morgen war man totgeschlagen; und es war nichts erreicht. Trappelten nicht schon die Füße der Verfolger? Voller Lärm das Leben, voller Haß und Angst: so ging es nicht. Mauern, Mauern! Hier waren Mauern, hier, hier!
Eine stürmische Freude über die Masse, die draußen über die Höfe wogte, durchdrang Ma-noh. Seine, seine Brüder und Schwestern, sie sollten den guten Weg gehen; seine Menschen. Besser als die Cakyasöhne.
Nachdem eine Stunde verstrichen war, kamen Männer vor das Zimmer, klopften an, ohne eine Antwort zu erhalten. Sie fanden Ma, den kleinen dürren Mann, auf dem Bett eingeschlafen, er schien sehr entzückt zu träumen. Er sprang auf, als sie leise wieder die Stufen heruntergingen.
Er war sehr still, ließ sich von ihnen die Hütte zeigen, die man für ihn bestimmt hatte, bezog sie.
An diesem Tage und am folgenden kamen keine Angreifer; die Gebrochenen Melonen zogen in gewohnter Art aus. Als schon fünf Tage verstrichen waren, hatte Ma-noh kein Wort darüber verlauten lassen, was weiter geschehen sollte. Er wartete. Wenn er die Höfe abging, war seine fliehende Stirn in Falten gelegt; man störte ihn nicht; sein Ausdruck war gefährlich. Ma mußte an sich halten; er sah die Grenzen seines Vermögens; der Bund stürzte in Abgründe und er konnte es nicht hindern. Zähneknirschend mußte er warten, bis die Brüder zu ihm kamen, selbst um Mauern bettelten. Er wagte diesen Vorstoß gegen ihre Freiheit nicht; er hatte Widersacher; man würde ihm nicht folgen. Sie genossen ihre Sicherheit. Sie wollten das Schicksal herausfordern; es sollte sich nur entladen!
Juen mit einem fast quadratischen Gesicht, einer auffällig plattliegenden Nase, kalten Blicken, einem Schädel fast ohne Hinterhaupt, hatte eine sehr wechselnde Art zu sprechen; meist sprach er hingehalten, klebend; ab und zu, es konnte sich um belanglose Sachen handeln, erging er sich in einem rapiden, scheinbar unmotivierten Ausbruch, mit hitziger Mimik und Geste, so daß man im ganzen die Vorstellung einer erheblichen Selbstbeherrschung des Mannes gewann. Im Grunde konnte davon keine Rede sein; er beherrschte sich, aber er beherrschte keine besondere Leidenschaft. Anfang dreißig, aus Sze-chuan gebürtig, Sohn eines reichen Federhändlers, im untersten Examen durchgefallen, ehrgeizig ohne Gaben. Er war bald träge, matt, bald wild; meist wild, er fürchtete seine Unklarheit vorzubringen. Er suchte unter die Bündler einzudringen, sich Ansehen zu verschaffen, indem er mit dunklen Worten in Erregung um sich warf, Worte, über die er selbst später nachdachte, weil er annahm, daß jede Gedankenarbeit in solcher Blindheit geleistet würde.
Die beiden Vettern Liu mehr banalen Charakters, Fanatiker, sehr ähnlich in ihrer Denkweise, etwa gleichaltrig; der kleinere Liu, der sich nach seinem Kindsnamen das Dreierlein nannte, zwar sanguinisch wie der andere, dabei aber zweifelsüchtig, fürchtend, daß nichts aus allem Gehofften würde, durch seine fatale Zweifelsucht selbst viel bedrückt. Sie arbeiteten früher in einem Porzellanwerk, dann ohne Beschäftigung verfielen beide aufs Goldmachen, das ihnen ein frecher Bonze beibringen wollte. Auch jetzt schleppten sie noch kleine Zinnoberkrügchen mit sich herum; sie erwarteten Großes von den Kräften, die ihnen das Wandeln im Tao verleihen würde: vielleicht würde ihnen die unsterblich machende Pille gelingen.
Juen verwickelte zuerst den Führer ihres Bundes in ein Gespräch darüber, was nun geschehen sollte. Er fügte sofort hinzu, daß nach seiner Ansicht es gar nicht nötig sei, das Kloster zu verlassen. Die Priester würden sich schwer hüten, einen tätlichen Angriff zu inspirieren; und ob die Regierung ihnen helfen würde aus freien Stücken, dürfte sehr zweifelhaft sein.
Ma-noh zeigte sich interessiert, legte ihm nahe, herumzuhören, was man dächte über die Zukunft des Bundes.
Die beiden Liu waren bei allem Fanatismus tatsachengeschulte Köpfe. Sie hatten unter sich oft die Frage ihres Bundes diskutiert. Für sie stand im Vordergrund: der Bund dehnt sich aus, er wird von wahrhaft ernsten Gedanken getragen, man muß ihm Zeit zur völligen Reife lassen; aber sobald es Winter wurde, in ein paar Monaten, mußte es zu Ende sein mit der Gebrochenen Melone. Sie hatten von Ma-noh einmal die entsetzliche Geschichte der Bergläufer von Nan-ku bei einem verschwiegenen Spaziergang gehört; sie zweifelten beide nicht daran, daß das Winterschicksal der Gebrochenen Melone an Grausigkeit nicht zurückstehen würde.
Was sie eigentlich genauer und präzis beschrieben mit der „völligen Reife des Bundes“ meinten, wußten sie so wenig wie die meisten anderen, die ähnliche Wendungen gebrauchten. Es war eine zu intensive Suggestividee, die jeder Zergliederung spottete, die bei der Berührung Schrecken einflößte. Die Idee ruhte im Hintergrunde, man konnte sich auf sie verlassen, man vernachlässigte sie, man lebte den vorgeschriebenen Regeln nach und war gewiß, daß automatisch zu einer gewissen Zeit die Dinge, welche die Idee verhieß, sich erfüllen würden.
Beide stimmten ohne weiteres Juen bei, daß man das Kloster behalten müsse. Nur das Dreierlein fing zu nörgeln an. Ob wirklich die Regierung nicht angreifen würde, und dann sei der Platz für die Dauer zu klein, und woher für immer die Nahrung.
Zu ihren Debatten zogen sie einen sehr phantastischen professionellen Geschichtenerzähler namens Cha hinzu, der immer mit nacktem Oberkörper ging, um möglichst viel von dem wirksamen Prinzip der Sonne, dem Yang, in sich aufzunehmen. Ein gutmütiger Kauz mit schönen lebendigen und jungen Augen, ein Mann, dem alle vertrauten, die mit ihm in Berührung kamen.
Ferner nahm Teil an den Unterhaltungen ein großer ernster Mensch, der vielleicht in der Mitte der vierziger Jahre stand, Namen und Herkunft nicht angab. Ma-noh wußte allein sein Schicksal. Er war hager, trug einen ungepflegt hängenden Kinn- und Schnurbart, war von einer außerordentlichen Güte und Höflichkeit gegen jedermann, dabei von einer ebenso großen Scheu und Passivität. Vielleicht war niemand unter den Bündlern so korrekt in den Gebeten und in der Wachsamkeit über seine Gedanken, so behutsam in der Beachtung der Regel, nichts, weder Pflanze, noch Tier, noch Mensch unnötig zu verletzen. Man nannte ihn die „Gelbe Glocke“, weil er fast beständig in einer bestimmten Tonlage sprach, die dem Grundton Gung des ersten Tonleiterrohrs entsprach, und dieses Rohr hieß Huang-dschung oder die Gelbe Glocke. Die Gelbe Glocke war, das wußte man allgemein, der vertraute Freund der schönen Liang-li, die ihr herrisches, leichtaufbrausendes Wesen in seiner Gegenwart wunderbar beruhigte. Man zog diesen unbekannten Menschen auch darum viel zu wichtigen Besprechungen zu, weil man Frauen zwar nie an Beratungen teilnehmen ließ, aber Liang gern mittelbar hören wollte.
Der alte Cha äußerte sich negativ. Dieser Märchenerzähler wußte aufs schärfste Märchen und Wirklichkeit zu trennen. Er stimmte den Gründen des kleineren Liu bei und zwar mit strenger Bestimmtheit, machte Juen Vorwürfe, wie er auf so niedrige Gedanken kommen könne, das Kloster den frommen Mönchen mit Hinterlist abzunehmen. Er eiferte sich in eine große Erregung mehrere Male hinein. Bei diesen Erregungen verlor er den realen Boden, watete in Wut, kämpfte gegen kolossale Größen, gegen Mammuts der Phantasie, die gar nicht in Frage kamen. Endete so, daß er nur an seiner drohenden Kopfhaltung und dem schmetternden Tönen seiner Stimme erkannte, daß er sich gegen etwas gewandt hatte; wartete eine Entgegnung ab.
Die Gelbe Glocke säuselte monoton; er wich aus, um nicht zu widersprechen. Beschäftigte sich damit, den alten Cha erschreckt anzusehen und ihm einige verbindliche Redensarten zu machen über die Stärke seiner Vorstellungskraft und seine Gesinnung. Nach seiner Meinung gefragt dankte er für die Güte, ihn für urteilsfähig zu halten. Er fühle sich diesen wichtigen Entscheidungen nicht gewachsen, vertraue dem Beschluß der andern völlig und unbedingt. Schließlich rückte er mit seiner eigenen Ansicht heraus, von der er aber ausdrücklich bemerkte, daß sie nur die Richtschnur für sein privates Dasein abgebe und daß er nie und um alles in der Welt nicht wolle, daß andere sie für eine wirkliche Meinung ansehen. Und schließlich äußere er sie nur, weil die Herren es wünschten und er die Herren nicht verletzen wolle.
Er könne sich nur der Ansicht des weltkundigen Herrn Cha anschließen. Ja wenn er es recht erwäge, könne und müsse er noch weitergehen, wenigstens was ihn anlange. Man müsse sehen, wie man dem Winter und dem Hunger in der alten Weise widerstünde. Wenn es aber sehr schlimm ginge, so müsse man sterben, denn das sei das Schicksal. Und sie würden ja auch sterben, denn sie begehrten alle nur nach dem Tao und nicht nach dem Leben. Wenn sie den Frühling erlebten, so sei dies etwas Wunderbares und kaum Glaubliches. Schließlich wüßte er nicht einmal, ob man dafür danken solle, denn jeder Tag früher am Ziel sei wahrscheinlich verdienstlicher als jeder Tag später. Doch dies alles wüßten ja die alten Männer besser als er, und er verletze sie nur durch den Vortrag gedankenloser Banalitäten.
Damit hatte die Gelbe Glocke getönt. Der große stille Mensch sah beschämt auf den Boden, die Äußerung bereitete ihm Pein.
Ma-noh hockte eines Morgens mit den vier Männern auf einem inneren Hof, der weit nach hinten gelegen steil anstieg und zu den Gräbern der Mönche führte. Dicht wucherte hier das Gras zwischen den Steinen, der Hof war mit alten Ulmen bepflanzt. In ihrem Schatten saßen die Männer, auch die schöne Liang saß hier, in einem gelben durchlöcherten und geflickten Kittel. Ihr hartgeschnittenes Gesicht war magerer geworden, die früher energischen Bewegungen hatten eine gewisse sanfte Rundung angenommen, ihre schmalen Augen warfen das alte schwarze Feuer.
Ma-noh war von ihnen zu dieser Unterredung gebeten worden. Juen erzählte von ihren Sorgen und Besprechungen. Ma-noh stimmte bei, man müsse sich Sorgen machen. Aber die Meinungen wichen ab, berichtete Juen, der sich als Wortführer benahm, und lud mit einer Handbewegung den jüngeren Liu ein zu reden.
Ma ließ diese Reden über sich ergehen. Er wußte, es würde keine Klarheit erzielt werden. Wang-luns längst widerlegte Gedanken waren zu kräftig in diesen Leuten.
Das Schicksal mußte deutlicher reden. Er wand sich unter den Dingen, die er kommen sah und die sich nicht abwenden ließen. Er litt unter seiner Ohnmacht.
Die schöne Liang-li, zum ersten Male zu einer Unterredung zugezogen, blickte ihn an. Sie hatte zunächst über dem Herzen ein Gefühl von schweigendem Zorn gegen Ma-noh. Aber nur einen Augenblick. Dies war kein Mann wie die andern, wie ihr Vater, ihr rechtlicher Gemahl, ihre Freunde vom Bund, die Gelbe Glocke. Diesem war sie nicht dadurch gleichgestellt, daß sie neben ihm beraten durfte und ihm ins Gesicht blickte. Es war schwer zu denken, daß von diesem Mann die Bildung ihres Liebesbundes ausgehen sollte. Und sie erfaßte in einer unklaren Weise, daß für Ma-noh ihr Bund etwas anderes war als für sie, daß keine Herzlichkeit dahintersteckte, sondern etwas würgend Qualvolles, etwas Gefahrdrohendes, ein Steinschlag.
Sie erschrak, erinnerte sich ihrer ersten Vorstellungen von ihm: als eines unheimlichen, abgewandten Mannes, der seine finstere Berghöhle verlassend, den großen wahren Weg ging und mit Leichtigkeit diejenigen mitriß, die sich an ihn hängten. Man durfte ihn nicht hemmen. Der Gedanke war unwahrscheinlich und entsetzlich, daß er sich beirren ließ.
Ma-noh redete in unverständlicher Ruhe. Der Bund würde bald zugrunde gehen. Entweder würden die Provinzialtruppen anmarschieren oder der Winter käme.
Es würde noch ein paar Monate so gehen, dann würden alle auseinanderlaufen zu ihren Sippen oder auf die Landstraßen oder vor die kaiserlichen Reisverteilungsstellen. Man könne nicht erwarten, daß ein Blutbad wie neulich ohne Einfluß auf die Haltung einer großen Menge bliebe. Der Zustrom werde von jetzt ab aufhören. Und welchen Schluß sollte man daraus ziehen? Daß man alles seinen Lauf nehmen lasse wie es wolle. Er sei völlig ohne Hoffnung für den Bund. Bald würde man Hetzjagden auf sie veranstalten, das sei nur eine Frage der Zeit. Bleibe jeder für sich. Finde sich jeder ein in das starre Schicksal.
Dies klang dem großen fremden Menschen, der Gelbe Glocke genannt wurde, angenehm in die Ohren. Er summte vor sich hin, daß das Schicksal seinen Weg gehe; es fiele jeden Menschen auf eine besondere Art an. Man müsse sich ablösen von rechts und links, um seinem Schicksal nicht auszuweichen.
Juen und die beiden Liu zogen die Beine hoch, schielten auf den Boden. Juen stand auf; das ginge nicht, das ginge nicht. So dächten nicht einmal die Einsiedler der Buddhareligion, denen die Gemeinschaft der Frommen noch ein heiliges Gut bedeute. Er war trotz seiner überlegten Worte erregt und giftig. Die Gelbe Glocke liebte er nicht. Juen mußte sich zusammennehmen, um nicht zu höhnen.
Den feinen Kopf gegen Juen gehoben, fragte Liang, wie sich der kluge Lehrer aus Sze-chuan das Schicksal der Gebrochenen Melonen denke; ob sie ewig leben sollten, als hätten sie schon das dünne Jadepulver gefunden.
Ma-nohs Lächeln in diesem Augenblick war von so bestimmtem Hochmut, daß Liang mit offenem Munde von ihm abrückte und die Blicke der vier andern auf Ma-noh lenkte. Dessen Lächeln blieb unbeweglich, starr vor aller Augen, stehen und verwandelte sich erst, als der ältere Liu ihn anrief, was er denke, in ein runzliges Grinsen.
Ma sagte: „Mich freut die Klugheit unserer Schwester Liang-li. Schöne Öfen haben einige Dichter die Frauen genannt; aber Juen denkt dies wohl jetzt nicht mehr, nachdem ein kleiner Funke aus dem schönen Ofen ihn gesengt hat. Wie heißt übrigens der wundervolle Vers, Juen, den du mir neulich sagtest, von dir selbst oder von einem Dichter der Tangdynastie? “
Juen verneigte sich geschmeichelt; er zitierte: „Es ist ein Vers Tu-fus, des unglücklichen Zensors unter dem Kaiser Schön-tsung: Das Tor des Panglaipalastes ist gegen den Südberg gerichtet. Himmelan reckt sich der eherne Säulenschaft mit den Schalen, in denen sich der Tau sammelt. Westwärts liegt der Jaspissee, zu dem die Königliche Mutter hinabsteigt. “ Liang hob die linke Hand gegen Juen auf: „Und ein anderer Vers lautet, er ist von Juen-o-tsai: Verflogen ist das bunte Wolkenspiel, ehe noch die gelbe Hirse gar gekocht. “
Die Gelbe Glocke platzte da mit einem Gelächter heraus, das aus Ochsenställen, Soldatenhorden zu schallen schien, aber gar nicht zu ihm paßte, und ohne daß sich sagen ließ wie, etwas von seiner Vergangenheit zu enthüllen schien. Er bat schon in einer unsäglich gequälten Weise um Entschuldigung. Er wäre in Gedanken versunken gewesen, sein Lachen habe mit den Äußerungen irgendeines Anwesenden nicht das Geringste zu tun. Immerhin machte dieser grobe plötzliche Ausbruch einen derart unangenehmen Eindruck auf die andern, daß sie schwiegen, aneinander vorbei sahen und Liang Ma-noh fragte, ob er nicht lieber herumgehen wolle oder auf einer Matte sitzen, da er so zusammenschauere.
Aber Ma-noh, der wirklich aufstand, setzte sich nur neben die Gelbe Glocke, die er beruhigte. Der kluge Mann sagte, indem er alle anlächelte und sich zu Juen umwandte, daß offenbar das Leben nicht ohne Einfluß auf sie geblieben sei. Man erleidet soviel und wird immer unfähiger, sich zu entschließen:
„Wir sind Fliegen, denen Kinder die Beine und Flügel ausgerissen haben. “
Juen zuckte die Achseln, zappelte, verschwand, um wieder strahlend die Hallen zu inspizieren, die Kapellen zu bewundern.
Liang ging neben der Gelben Glocke und Ma-noh nach dem offenen Klostertor über die lichtbeschienenen gewundenen Höfe. Ma hatte das Gefühl, daß er diese beiden wie einen Steinsack auf seinem Rücken schleppte. Die Gelbe Glocke war der furchtbarste Mensch unter allen Bündlern. Er hätte ihn fallen lassen können, aber sein Ehrgeiz verlangte diesen Mann; er mußte ihn, er mußte ihn bewältigen.
Der schönen Liang bangte um ihr Schicksal. Das hochmütige Lächeln Mas konnte sie nicht aus der Erinnerung wischen. Es war wie der Blick eines weißen Tigers von einem Felsen herunter auf den Menschen, der ahnungslos um die Ecke bog. Was hatte dieser Mann vor?
Bei den strengen Blicken Mas auf die stumme Gelbe Glocke besann sich die schöne Liang. Sie steuerten nach den glücklichen Inseln. Der Steuermann auf so furchtbarer Fahrt mußte furchtbar sein. Die Gelbe Glocke ging gelassen neben ihr.
Und in aller Ruhe hatte sich jener Wink vorbereitet, den Ma-noh ahnte. Als am siebenten Tage ein Zug von sechzig Landleuten an Ma-nohs Klostertor klopfte, erreichte der Wink die Gebrochene Melone.
Der Bund hatte seinen Wohnsitz in einem der reichsten Distrikte Westtschi-lis; es wurde hier Baumwolle gepflanzt, die Seidenraupenzucht stand in hoher Entwicklung.
Eine Eigentümlichkeit des Landes bildete das Vorkommen wirklicher Salzbrunnen. Man hatte im Laufe der Jahrzehnte eine große Menge gebohrt und ganze Erwerbe hingen mit den Brunnen zusammen. Man grub zur Salzgewinnung ein meterweites trichterförmiges Loch, bis man auf Wasser stieß. Unten ließ man die Lauge sich sammeln, abdunsten; sie wurde mit Eimern nach oben geschafft. Wie am Meere teilten sich in die weitere Verarbeitung die Salzsieder, Salzpfänner und Stapler. In riesigen Kesseln und Pfannen jagten die Salzsieder das Wasser aus der Mutterlauge. Das Gras zum Heizen der Kessel lieferten reichere Steppen- und Landbesitzer, welche meist gleichzeitig das Salz aufstapelten, den Transport übernahmen, die vorgeschriebene Menge an den kaiserlichen Hauptstapelplatz abführten. Wer von den Brunnenbohrern genügend Land besaß, konnte rascher arbeiten, das salzhaltige Grundwasser über abgedichtete Erdflächen fließen lassen, die Verdunstung an der Sonne beschleunigen. Der Transport der gewonnenen steuerpflichtigen Salzmassen erfolgte fast nur auf dem Wasserwege; eine nicht zu große Strecke mußte man das Produkt zum nächsten Fluß oder Kanal transportierten auf Mauleseln, Karren, Ochsenwagen.
Nun war vor neun Jahren der Vater eines Mannes namens Hou in diesem Distrikt von den schwarzen Blattern hingerafft worden. Es war ein anerkannt tüchtiger Justizbeamter, von der größten Schlichtheit und Strenge, wegen seiner Kürze und Bündigkeit im Rechtsprechen sehr gefürchtet. Durch kluge Berechnungen beim Ankauf von Reis, den er wieder an die Regierung verkaufen ließ, hatte es der Mann zu großem Reichtum gebracht. Er kaufte sich weite Ländereien. Nachdem er den vierten Grad erreicht hatte, zog er sich zurück, machte der kaiserlichen Privatschatulle Geschenke, spekulierte umsichtig weiter und kam eines Tages von einer Überlandfahrt matt zurück; man mußte den schwerleibigen Mann aus der Sänfte heben; er starb bald.
Sein ältester Sohn, der jetzige Besitzer Hou, als Kind durch Kränklichkeit die Sorge der Familie, stand an Schlauheit hinter seinem Vater nicht zurück; aber während der Alte die Menschen benutzte, wie sie sich ihm anboten, war er ohne Motiv hart und kalt gegen jedermann. Die äußere Gestalt hatte er völlig von dem Vater, die Plumpheit der Glieder, die Schwerfälligkeit, das vertrauliche Platt des Dialekts. Er prunkte nicht, hielt die vorgeschriebenen Riten streng inne, führte ein musterhaftes Familienleben. Trotz aller Härte im Handeln atmete er eine gewisse Jovialität, so daß manche der niedrigen Leute, die nicht geschäftlich mit ihm zu tun hatten, ihm aufrichtig anhingen. Er mehrte seinen Besitz, obwohl ihm der Weitblick des Vaters nicht gegeben war.
Zwei Jahre nach der Beerdigung des Alten begann Hou das Unglück zu verfolgen. In einem Monat starben ihm zwei Söhne an einer unbekannten Krankheit, bei der sie tagelang steif dalagen, den Kopf verdrehten, zu toben anfingen und zugrunde gingen, ehe man den fraglichen Dämon festgestellt hatte. Bei einigen waghalsigen Spekulationen, die nach Art der väterlichen erfolgten, ließ ihn sein bester Freund im südlichen Tschi-li im Stich; Hou häufte große Massen von Reis in seinen Speichern an; durch raschen Wegtransport der Reislager des Freundes sollte es im südlichen Distrikt zu einer künstlichen Preissteigerung kommen, die Hou benutzen wollte. Aber angeblich konnte der Freund die bestellten großen Kähne nicht zur Zeit erhalten; Hou saß mit riesigen Vorräten fest. Es erfolgten zweimal in kurzen Abständen Brandstiftungen auf seinen Gütern mit schweren Verlusten. Da trat eine Wendung ein.
Hou hatte schon oft mit einer peinlichen Empfindung den Kanal, der vor seiner Villa vorbeizog, betrachtet; die langen Kähne, die den Salztransport, auch den Transport von Trauben, Pflaumen, Birnen besorgten, die Schreie der Schiffszieher, das Knarren der Taue an dem Kanalbord; man konnte von hier rasch hinauffahren zu einem breiten Seitenarm des Kaiserkanals.
Ein Astrologe besuchte ihn damals aus Pe-king, der wegen seiner Unwissenheit aus dem Dienste des Ritenministeriums entlassen war. Da dieser nicht in die Geheimnisse der Berechnung wichtiger Ereignisse eingedrungen war, hatte er sich auf ein schimpfliches Gewerbe gelegt, das ihm durch seine würdevolle Gestalt, sein vertrauenerweckendes zurückhaltendes Benehmen erleichtert wurde; er wurde zum Kommissionär für umfangreiche Kinderverkäufe nach den südlichen Provinzen, dem Nachwuchs für die Freudenhäuser und Theater. Dies geschah unter der Maske der Adoption oder Beschaffung von Adoptionen; gelegentlich besorgte er auch Apothekern oder sehr reichen Kranken kleine Kinder, deren Augen, Lebern und Blut verarbeitet und benutzt wurden. Nebenbei war dieser Mann ein sehr geschätzter Heiratsvermittler.
Als er mit Hou in einem Pavillon des Gutes bei dem kleinen Kanal saß und der schwer heimgesuchte Freund ihm seine Leiden erzählte, saßen sie eine kleine Weile die Wasserpfeife rauchend da und betrachteten drüben das Arbeiten der Schiffzieher, die eine Fahrrinne in das gefrorene Wasser schlugen.
Der Astrologe fragte, ob Hou auch das Land jenseits des Kanals gehöre und wie weit, und was für Waren hier transportiert würden.
Nach ein paar gurgelnden Pfeifenzügen meinte dann der Besucher, der Kanal müsse geschlossen werden.
Hou begriff sofort, lachte, mahnte leise zu sprechen. Es wäre ja gut, wenn der Kanal geschlossen würde, aber gar nicht möglich, das zu erreichen; freilich wenn es auf irgendeine erdenkliche Weise sich machen ließe, würde er seinen Freund natürlich nicht vergessen. Der Kanal sei wichtig für die und die und die; wenn man ihn schließen könnte, so würde dabei ein enormer Gewinn heraussehen.
Der würdige, einfach schwarz gekleidete Astrolog dankte für die eventuelle Gewinnbeteiligung; davon später. Er saß nachdenklich, sprach plötzlich schwermütig von dem Tod des alten Hou, den der Kaiser hoch geschätzt habe, und wann man ihn beerdigt hätte, wer den Ort bestimmt hätte. Dann ging er, ohne Hou aufzuklären, wehklagend über den frühen Tod des Hou, dieses wahrhaften Freundes des Landes, in das Wohnhaus mit seinem Freunde, zündete Kerzen vor der Ahnentafel des Hauses an. Er verabschiedete sich und zog sich zum Nachdenken, wie er sagte, in das ihm angewiesene Gastzimmer zurück.
Am nächsten Morgen ließ er sich, begleitet von dem triefäugigen stieseligen Ortsastrologen, nach der Grabstätte des alten Hou tragen, ausgerüstet mit den Arbeitsinstrumenten, dem Kompaß, der Tiertafel, der Windrute. Nach dreitägigen Untersuchungen stellten die beiden vergleichende Berechnungen umfangreicher Art an und kamen zu dem Resultat, daß die Grabanlage durch die Führung des Kanals gestört würde. Es war angesichts der Enge der Örtlichkeit nicht einmal möglich, die Grabruhe des Geistes zu verbessern durch eine abwehrende Pagodenerrichtung. Daher also das Unglück im Hause des Hou nach dem Tode des Alten.
Hou verstand den raffinierten Astrologen nicht. Als der zu jammern anfing über das Los des verdienstvollen Mannes, warf sich Hou heulend auf den Boden, wußte sich keinen Rat. Er rannte vor die Ahnentafel; er wollte dieses Vergehen nicht auf sich nehmen, er mußte dem Toten mitteilen, daß er nicht Schuld an dieser Grabanlage sei, nicht er; wie sollte er doch, der dankbare täglich opfernde Sohn, auf den schauerlichen Gedanken kommen, den toten Vater ruhelos herumzuhetzen. Den Astrologen umschlang er hilfeflehend, und da sah er zu seinem Erstaunen in ein verschmitzt schiefes, fettpralles Gesicht. Der Astrolog schnaufte, von den dicken Armen gedrückt, schob seinen Freund zurück, beendete die Räucherung, und sie gingen langsam in den Gartenpavillon am Kanal. Der phlegmatische Mann aus Pe-king sagte mit einer ministerialen Stimme: „Wir dürfen den schwer beleidigten Geist deines Vaters nicht noch mehr kränken und das Grab verlegen. Dies wäre der Gipfel der Mißachtung. Die Richtung des Kanals muß geändert werden. Dieser Kanal ist schleunigst zu schließen. “ Leidend grunzte der dicke Hou: „Ja, ja,“, und dann nach einer Pause, während der sie sich ernst ansahen, mit einer helleren Stimme: „Ja, ja. “
Den nun folgenden monatelangen Schriftwechsel mit den Provinzialbehörden und dem kompetenten Ministerium der Riten nahm der Astrolog dem betrübten, fassungslosen Sohne völlig ab. Es vergingen Wochen, da Gutachter des kaiserlichen astrologischen Büros mit Abfassung eines Immediatberichts beauftragt worden waren, nachdem die nachgeordneten Instanzen das Gesuch Hous wegen seines volksschädlichen Ansinnens erst zurückgewiesen hatten. Khien-lung aber, selbst informiert, erklärte kurzer Hand: „Ein Kanal kann anders gezogen werden; bis zum Bau eines so kleinen Kanals, der beschleunigt werden soll, existieren andere provisorische Transportmittel. Es ist niedrig, einen Toten von dem bleibenden Verdienst Hous aus der Ruhe aufzujagen wegen lokaler vorübergehender Unbequemlichkeiten. “
Damit war der Fall erledigt. Und ohne daß die Gilden der Schiffzieher, Salzsieder, Lastenträger, Karrenverleiher in den westwärts gelegenen Dörfern orientiert wurden, schloß man die Schleusen in höchster Eile, leitete das Wasser in einen See ab, zu dem Hou schon in währender Verhandlung einen Verbindungsarm hatte graben lassen. Der Warentransport mußte auf eine ganz andere Weise erfolgen; es mußte umgeladen werden, eine Strecke von einer Tagelänge ging der Transport auf dem Landwege über Hous Liegenschaften weiter, bis an das nunmehrige Endstück des Kanals. Den ersten Lastenträgern, Karrenführern verwehrte Hou den Eintritt in sein Gebiet. Schleunige Interventionen bei der Präfektur bewirkten, daß ein vorläufig unentgeltlicher Durchzug gestattet wurde; Hou wurde anheimgestellt, sich mit den in Frage kommenden Gewerkschaften ins Benehmen zu setzen, eiligst eine Durchgangsstraße zum Kanal anzulegen.
Er fügte sich ohne weiteres, erhob aber für die Benützung seines Grundstücks mit baldiger Genehmigung der Behörden einen kleinen Zoll, errichtete aus freien Stücken fünf Lagerschuppen an der Straße, half den Transportarbeitern, indem er große Aushilfswagen und Ochsen zu ihrer Verfügung hielt. Der Gewinn war enorm; es kam hinzu der Gewinn aus Diebstählen, die bei dem häufigen Umladen, Aufspeichern sich nicht vermeiden ließen; schließlich lief es darauf hinaus, aus seinem Grundstück den naturgemäßen Hauptstapelplatz für Salz zu machen, indem Hou nämlich Leuten, die anderswo stapelten, den Durchzug schikanös erschwerte.
Wochenlang blieb es still; ununterbrochen besprachen sich die Gilden in dem betroffenen Distrikt. Es regnete in der Präfektur Eingaben. Die Schiffzieher, unbeschäftigt, arbeiteten bei den Salzpfännern; diese selbst, soweit sie nicht an Hou Gras lieferten, verloren Einnahmen aus dem Rückgang der Stapelgebühren. Die Erregung wuchs.
Da legte sich ein frisch angekommener Präfekt ins Zeug in einer Weise, die ihm fast den Kopf kostete. In den westlichen Departements war der Fall Hous nichts Absonderliches. Ungeheuerliche Steuerhinterziehungen wurden von den großen Grundbesitzern seit Jahrzehnten getrieben; Seidenspinnereien, Mühlenbesitzer bezahlten nicht mehr Steuer als ein unbedeutender Handlanger in ihrem Betriebe. Im Register des Steueramts standen diese reichen Herren mit einem winzigen Äckerchen eingetragen, eben dem Besitz, den ihre Väter und Großväter zum Ausgang genommen hatten; man hatte es durch gute Beziehungen zu Steuerdirektoren und Präfekten verstanden einzurichten, daß sich die Anfangsangaben in den Registern unerneuert forterbten; mit Falschmeldung von Brachland, Überschwemmungsgebieten half man nach.
Der genannte junge Präfekt fuhr, sobald ihm einige Fälle dieser Art hinterbracht waren, feierlich in das nächste kaiserliche Hauptsteueramt, wo die Listen auslagen, und berichtete dem Steuerdirektor mündlich im offenen Jamen in Gegenwart vieler Zuhörer, was ihm mitgeteilt sei, wies mit lauter Stimme auf den Gegensatz, der bestünde zwischen den Daten der Liste und dem tatsächlichen Besitz. Als er wieder in seine grüne Sänfte stieg, sahen sich seine Vorläufer und Träger betrübt an, sie trabten und schüttelten die Köpfe. Was die Diener im Hause des jungen Präfekten bei ihren flüsternden Gesprächen voraussagten, trat ein.
Der alte Steuerdirektor, ein beliebter, wegen seiner Ortskenntnisse in Tschi-li und Schan-tung bei der Regierung geschätzter Mann, ließ sich zehn Tage vertreten. Während dieser Zeit reiste er, wie er meldete, in den Kreisen seiner Besteuerungszone herum, um den Befund aufzunehmen, besuchte die gewerblichen Anlagen, die Güter. Die vom Präfekten aber gleichzeitig mit dem mündlichen Vortrag abgelassene Eingabe an die Zentralbehörde hatte er nicht aufhalten können; und schon bei seiner Rückkehr fand der graue Mandarin eine dringende Aufforderung vom Finanzministerium in Pe-king vor, Bericht über die Angaben des beigelegten Memorandums zu erstatten.
Während abendlich der jugendliche noch unverheiratete Präfekt am Teich der roten Lotosblätter lag und das Spiel der schwimmenden Blätter spielte mit seinen Freunden, rangen seine ortskundigen Diener die Hände über seine Kurzsichtigkeit; sie hatten von Mißstimmungen gehört, die im Lande gegen den Präfekten herrschten.
Es erhoben sich unvermutet kleine Unruhen bei Gefangennahmen von Dieben und öffentlichen Bestrafungen; größere folgten und begannen den Präfekten lebhafter zu beschäftigen. Schließlich kam es in mehreren bis da ruhigen Dörfern zu einem Angriff auf kaiserliche Beamte und Häuser. Eine scharfe Verfügung von oben wies ihn an, die Bewegung zu unterdrücken. Es gelang nicht; seine Polizei erwies sich als ohnmächtig. Als nachts ein vom Kaiser einer tugendhaften Witwe gesetzter Ehrenbogen auf offenem Markte abbrannte, schien die Stunde des Präfekten geschlagen.
Da lud ihn der dicke Hou zu einer Besprechung ein, die der Präfekt wegen der Transportstraße schon geplant hatte. Und jetzt löste sich die Krise auf die einfachste Weise. Der Präfekt hatte keine Wahl; er mußte an die Schande denken, die auf seine noch lebenden Eltern und auf seine Ahnen fallen würde, wenn man ihn degradierte; von seiner trostlosen Zukunft nicht zu reden.
Die Familie des Hou zeigte sich hochgeehrt durch seinen Besuch. Der rohe kriecherische Hou bot dem Präfekten, als er von den noch lebenden Eltern seines hohen Gastes hörte, einen Sommerwohnsitz auf einem seiner Güter für die betagten Leute an; er zwitscherte mit Ausdrücken größten Bedauerns von den augenblicklichen Schwierigkeiten in der Präfektur, stellte dem Beamten seine eigene vorzüglich geschulte und bewaffnete Gutspolizei zur Verfügung. Der eisige Präfekt antwortete nicht.
Vor seiner Ahnentafel opferte er und betete; sprach zwei Tage mit keinem seiner Freunde. Dann nahm er an.
An diesem Nachmittag erfolgte der glanzvolle Gegenbesuch des Hou in der Präfektur und dann in der Familienwohnung, zur aufrichtigen Freude der Anwohner und Diener des Hauses, die den Präfekten als weisen alten Mann priesen. Man klärte mit Leichtigkeit alle Mißverständnisse auf; es zeigte sich, daß Irrtum über Irrtum gehäuft war, Übertreibungen, Verwechslungen. Der glückliche Beamte konnte in weniger als zwei Wochen von der Zentralbehörde die Anerkennung dafür erhalten, daß es seiner Energie und Klugheit gelungen sei, die drohende lokale Rebellion zu unterdrücken. Nach einigen erfolglosen Exzessen der durch Hous Maßnahmen betroffenen Dorfbewohner wurde alles still.
Damals im Hochsommer verbreiteten sich hierher die Gerüchte von den frommen Bettlerbünden; einzelne Männer verließen ihre Heimat und suchten die Gebrochene Melone auf. Man hörte von den Intrigen und Angriffen, die auf die ruhigen Männer gerichtet wurden; dann kam das große Blutbad, die Mönche zogen aus dem lamaistischen Kloster; der eingeschreckte Haufe Ma-nohs versteckte sich hinter die festen Mauern.
Von einigen hier ansässigen Anhängern Mas wurden die Gilden und Sippengenossen über das Wesen und Schicksal des Bundes aufgeklärt. Sympathie mit den Vertriebenen, ein Gefühl von Solidarität mit ihnen setzte sich sofort fest. Zu dem neuen Kanal war noch kein Spatenstich getan, angeblich mangelte es infolge der Kriegsausgaben in den kaiserlichen Kassen an Geld; die Familien vieler Arbeitslosen wanderten nordwärts aus. Einige wüste Gerüchte trug man sich in den notleidenden Ortschaften von der Gebrochenen Melone zu; es sei ein verkappter politischer Bund, der mit der Weißen Wasserlilie unter einer Decke stecke; sie gingen wehrlos durch die Landschaften und ließen sich niedermetzeln; das geschähe, um das Volk aufzureizen und zu zeigen, daß man lahm, verkrüppelt und widerstandslos sein könne und doch den Gewalttätigkeiten der kriegerischen Mandschus und der betrügerischen Mandarine ausgeliefert.
Häufige Besprechungen zwischen den Insassen der verschiedenen Ortschaften führten zu dem Resultat, daß sich aus den Vertretern der einzelnen Gilden und Ortschaften eine Gruppe konstituierte, die, von den Staatsbehörden vernachlässigt, zu der Gebrochenen Melone unter Ma-noh zu wandern beschloß. Unklare Gedanken bei heftiger Erregung trieben diese Männer; man wollte sich mit Ma-noh, der schon in den Besitz eines Klosters sich gesetzt hatte, zusammentun und gemeinsam etwas zur Verbesserung der Zustände unternehmen.
Dies war der Zug regellos daherkommender Bauern und Arbeiter, vor denen sich die Tore des Klosters rasch verschlossen und rasch wieder öffneten. Als einige Brüder zu Ma-noh in die Hütte gestürzt kamen und ihm meldeten, daß eine Schar Bauern und Gewerkschaftler von freundlicher Gesinnung in das Kloster gezogen wäre und mit ihm zu sprechen begehrte, hielt Ma es nicht für wünschenswert, seine Vertrauten zu dieser Unterredung hinzuzuziehen, ließ fünf der Männer in das Zimmer des Chan-po führen und erschien dann selbst.
Sie behandelten ihn wie einen Mächtigen, fielen vor ihm auf die Stirn; er mußte sie in Scham und Furcht, daß man dies sähe, bitten, ihn wie ihresgleichen anzusehen; er sei ihresgleichen, ein armer Sohn des schwarzhaarigen Volkes der hundert Familien. Und was sie also wollten, wer sie schickte.
Sie lächelten sich auf die Frage an; auf eine Bewegung Mas kauerten sie im Halbkreis am Boden hin. Dann schwiegen sie, weil sie nicht wußten, wer sprechen sollte.
Es waren fünf ältere Männer, drei Salzsieder, einer der verarmten Salzpfänner, ein Karrenführer; in Beratungen zu Hause leisteten diese gescheiten Köpfe Vortreffliches; hier drückte sie das Gefühl, mit einem Manne von dem Rufe Mas zusammenzusitzen, und auch ihre Unklarheit über die Ziele dieses Mannes. Der Salzpfänner, der gebildetste von ihnen, öffnete den Mund, sah alle nacheinander an und erklärte lächelnd und sich verneigend, da keiner ihm zu widersprechen scheine, so wolle er reden. Und er erzählte mit ein paar hingeworfenen Sätzen, wer sie einzeln wären, wo sie wohnten, daß sie von den großen Landbesitzern und den Mandarinen schlecht behandelt würden.
Der Karrenführer, der ihm gespannt zuhörte und bei jedem Wort zustimmend nickte, fuhr unmittelbar fort: „Und dies ist die Hauptsache. Und darum dreht es sich. Wir können nichts machen. Die Präfektur gibt keine Antwort auf unsere Eingaben. Wer bist du nun, Ma-noh? Woher stammst du, wo wohnen deine glückgesegneten Eltern? Vor allem: was soll geschehen? “
„Darum dreht es sich“, wandte sich einer der Salzsieder mit einer brummigen Stimme an den flinken Karrenführer, „die Hauptsache bleibt und ist, wie ich immer gesagt habe: was soll geschehen? Und wie soll man es machen? “
Der Karrenführer begütigte ihn mit Handbewegungen und zwinkerte Ma an: „Er meint es nicht so. Wir streiten uns manchmal, weil unser beider weiblicher Hausjammer sich nicht verträgt. Wenn ich sage: ‚Wie soll man es machen? ‘ sagt er, das sei falsch; man muß fragen, wie es am besten vorangeht; und wenn ich ‚Hott‘ sage, findet er mich ungebildet und geschnattert, und entschließt sich dann zu einem ‚Hü‘. Das ist in unserem Dorf bekannt und noch weiter weg, er ist ein guter Junge, nicht wahr? “
Er fragte den Pfänner, der viel hustete und krächzte und sich die Nase rieb; unwillig wies er den Mann zurück: „Macht das ab, wo ihr wollt; ich habe zwischen euch beiden nicht zu entscheiden. Wir sind hier nicht einen halben Tag hermarschiert, um zu entscheiden, ob es besser ist, ‚Hott‘ oder ‚Hü‘ zu sagen. Worum es sich dreht, es bleibt dabei, das ist die Hauptsache. “
Der Karrenführer streckte erstaunt die Hände aus, als wollte er sagen: „Das mein’ ich doch auch“, und stieß den verstimmten Salzsieder an, der aber abwinkte.
„Also“, wandte sich der erkältete Pfänner an Ma, „kommen wir zu dir, um dich anzuhören. Sechs meiner Dorfgenossen sind zu deinem Bunde gegangen, und sie haben uns von dir und den andern erzählt. Ihr nennt euch ja Brüder und Schwestern, was wir alle sehr freundlich fanden. Willst du uns auch helfen? “
„Oder willst du etwas mit uns zusammen tun gegen die Besitzer und den Präfekten, die unter einer Decke stecken? “ Dies sprach ein anderer Salzsieder, ein langer dürrer Mensch, der in einem lehrerhaften Tone mit gehobenem Zeigefinger sprach, „wir werden gegen sie etwas tun in den nächsten Wochen, aber wir haben noch keinen Plan. “
„Der Plan, der Plan,“ nörgelte der Pfänner, „was ihr alle für Einfälle habt. Einen Plan werde ich euch schon verschaffen. Man muß nicht zu viel von einem Plan halten. Ich habe schon Leute gesehen mit den schönsten Plänen und es ist doch nichts aus ihnen geworden. Überhaupt soll uns Ma-noh erst die Frage beantworten, ob er sich uns kurz gesagt anschließt oder nicht? “
„Oder hilft oder nicht“, vervollständigte der flinke Karrenschieber.
Ma lauschte atemlos dieser simplen Unterhaltung. Ihn beunruhigte nur, daß zwei Salzsieder sich nicht an dem Gespräch beteiligt hatten; aber sie sahen schließlich nicht anders aus als ihre Gefährten. Dies war der Wink, den er erwartet hatte. In Ma ging es anders zu als in Wang-lun: während Wang es ängstlich vor sich verborgen hätte, daß zum Erschrecken etwas eintraf, was er voraussagte, fuhr es Ma mit einer warmen füllenden Sattheit in den Schlund und Bauch.
Ma hatte das Gefühl, daß das Schicksal sich unter ihm bog, er flatterte unsicher an der Vorstellung vorbei, die so lächerlich war, daß zauberisch sich sein Weg und das Tao übereinanderlegten. Während die Gewerkschaftler vor ihm diskutierten, saß er geblendet und schwitzte aus allen Poren in einer Art Rausch; er suchte seiner Herr zu werden.
Er sagte, er hätte keine Truppen, um ihnen zu helfen. Sie wüßten ja selbst, daß man die Gebrochene Melone verfolge und am liebsten ganz vernichten wolle. Geschlagen seien Dörfler und Gebrochene Melone. Man litte unter großen gewalttätigen Herren.
„Eben darum kommen wir in das Kloster her zu euch,“ stieß der Pfänner zurück, „wir Dörfler wissen uns eben bald keinen Rat mehr. Du bist sehr klug und kennst die Bücher und Berechnungen. “
Der lange Salzsieder, der in lehrhaft eindringlicher Weise zu reden pflegte, hob seinen Zeigefinger: „Dir ist noch etwas zu melden, Ma, weil du so ruhig einen nach dem andern anhörst. Es geht dich und die Brüder und Schwestern alle etwas an. Ich sage: alle geht es euch etwas an. Ein Neffe von mir ist Filzsohlenarbeiter in einem Dorf eine halbe Tagereise von hier; er wohnt jetzt in meinem Hause als Gast. Ein Arbeitskamerad hat ihn gestern aus seinem Dorf besucht und erzählt, daß fünfzig oder hundert Landpolizisten bewaffnet hinter euch her sind wegen des schrecklichen Gemetzels vor einer Woche. Sie sind schon unterwegs hierher und werden eher heute als morgen da sein. Was sie euch fragen werden und wie sie euch fragen, das werdet ihr schon sehen. Ich sage, wenn ihr so klug seid und einen nach dem andern anhört: es geht euch etwas an. “
Darauf lächelte Ma-noh: „Meine Schwestern und Brüder sind verloren vor den Menschen. Wer hilft uns? Wie lange Stunden werden meine willkommenen Gäste warten können auf einen Rat ihres Freundes Ma-noh aus Pu-to-schan? “
Sie sahen sich an, der Pfänner krächzte: „Wird es unserm klugen Freund genügen für seine Berechnungen, wenn wir bis mittag warten oder eine Stunde später? Unser Heimweg ist nicht sehr kurz, wirklich nicht, und wer weiß, was zu Hause angestellt wird. “
„Bis mittag. “
Sie trabten aus dem Zimmer. Ma-noh saß die lange Stunde allein vor dem leeren Buddhaaltare; zu denken vermochte er nicht.
Die Blendung verließ ihn nicht.
Das Schicksal bog sich unter ihm.
Keine Niedermetzelung mehr! Der Weg gesichert. Die stürmische Liebe zu den Brüdern und Schwestern, die blühende Hoffnung auf alle Herrlichkeit, das strahlende westliche Tor! Ihn packte das Glückgefühl so, daß er um Hilfe rufen wollte. Er lachte vor sich hin, leise, welche Aufgabe diesen fünf Boten gegeben war, diesen schamlosen kindischen, die ihr Leiden um Fressen und Saufen mit dem seiner Brüder und Schwestern verglichen. Aber sie sollten gesegnet sein! Wozu anders sollte man diese Bande von Salzsiedern, Lastenträgern verwenden, als zum Herumstellen, zu dienen als wandelnde Ziegelsteine, elastische Gräben, vortrefflich schließende Tore für die Gebrochene Melone!
Eine Stunde nach Mittag traten die fünf Leute in das Chan-pozimmer, wollten sich niederwerfen, rutschten zögernd auf die Kniepolster.
Ma-noh forschte den Salzpfänner noch einmal aus, wer sie geschickt hätte, wieviel Dörfer sie verträten.
Der antwortete mit der ungeduldigen Gegenfrage, was die Berechnungen ergeben hätten und wie es mit dem Rat stände. Da meinte Ma, indem er einem nach dem andern scharf ins Auge sah, daß er einen Rat nicht geben könne, aber sobald sie nach Hause aufbrechen würden, würde er sich mit ihnen auf den Weg machen und es kämen noch zwei, drei seiner Brüder und Schwestern mit. Er wolle an Ort und Stelle berechnen. Was nötig wäre und sich aus der Zeit, dem Übereinstimmen der Tiere und Metalle folgern ließe, würde sich dann ergeben.
Der Karrenführer staunte; er hielt dies für eine Entscheidung, die ganz außerordentlich den Kernpunkt der Sache träfe. Der gelehrte Salzsieder drehte den Kopf nach den Kameraden, als erwarte er eine Anerkennung, dann stand er auf, stellte sich neben Ma-noh und sagte leise zu ihm: „Ich will dir nämlich sagen, Ma aus Pu-to, daß der dumme Salzsieder, der neben dir steht, dasselbe vorhin auf dem Hof gedacht hat, wie du. Nur faßten die andern es natürlich nicht auf, sie lassen einen auch nicht zu Worte kommen. Ich habe es dann schließlich ganz für mich behalten. Man weiß ja allein, was man wert ist. “
Und er berührte vertraulich Ma bei der Schulter.
Der Pfänner konnte nicht gleich ins Reine kommen: „Also einen Rat, direkt so wie: ‚Geh dahin, geh dahin, hier vorbei, da herunter‘, gibt es offenbar nicht dabei. Es ist immer etwas Neues zu lernen. In den verschiedenen Sachen ist es ganz verschieden. Man sollte das gar nicht glauben. An Ort und Stelle muß auch berechnet werden, was man anfangen soll. Es hat etwas für sich. Es ist zweifellos; ich will es ja nicht leugnen. “
Und er fiel mit groben Worten den eitlen Kärrner an.
Während die Boten auf den Höfen mit ihren Heimatsgenossen sich besprachen, umlagert von unruhigen Brüdern und Schwestern, hatte Ma-noh mit seinen Vertrauten auf dem abgelegenen Gräberhof eine kurze und heftige Unterredung. Ma wünschte die Begleitung dieser Vertrauten.
Er wollte mit seiner Taktik des Wartens brechen. Er wünschte unbedingte Zustimmung, Unterwerfung unter das, was er plante. In einem herrisch knappen Tone brachte er seinen Wunsch vor, ihn in das Aufstandsgebiet zu begleiten.
Nur Juen wollte ihn begleiten; die Lius, besonders die Gelbe Glocke lehnten ab, sich in Kriegsdinge einzumischen. Die schöne Liang-li starrte Ma-noh an. Ihr graute je länger je mehr vor diesem Mann.
Da schlug Ma, der zwischen den Weidenstämmen hin und her ging, vor der Gruppe seiner Berater, einen ungemein erregten harten Ton an; er beschuldigte sie, daß sie ihn im Stich ließen, daß sie ihn, der schon ohne Mut sei, zu Boden stießen. Sie hätten kein Herz für die Brüder und Schwestern, die verjagt von Sippe, Gilde und Volk, bei ihnen Zuflucht suchten und wie Ratten, die man mit vergiftetem Mais füttert, hier in ein paar Tagen verrecken würden. Seine Vertrauten seien sie; aber statt ihm beizustehen, belasteten, erstickten sie ihn.
Die Gelbe Glocke wurde von einem heftigen Zittern bei diesen Anklagen ergriffen; er unterbrach schon manchmal mit einem Ausruf Ma; dann rang er nach Worten: „Du redest ungebührlich zu uns, Ma. Was diese Brüder hier erdulden wollen von dir, weiß ich nicht; du darfst nicht ungebührlich zu mir sprechen wie zu einem Haussklaven. Wir haben nichts verschuldet an dir. Du kamst kurz und ohne deine weise Haltung an. Du tobst. Dies haben wir nicht verdient. Das darfst du nicht wagen gegen uns. “
Er zitterte so stark, daß er, am Boden sitzend, nach vorn überfiel; über seine mageren braunen Backen liefen Tränen.
Aus Liangs Augen blitzte die Entrüstung; sie kam zu keiner Äußerung; der jüngere Liu, das zweifelsüchtige Dreierlein, stellte sich vor Ma hin; ruhig sagte er: „Wir Lius sind aus gröberem Metall als die Gelbe Glocke; wir weinen nicht. Ma behandelt uns jetzt nicht als Vertraute; warum will er mit den Bauern mitgehen, warum sollen wir ihn begleiten? Wenn wir nichts erfahren, wird er begreifen: wir Lius ertragen das Schimpfen; im übrigen tun wir, was wir für recht halten. “
Ma zwang sich. „Ihr, die Gelbe Glocke auch, werdet sofort begreifen, daß ich tobe, und werdet das Anklagen gegen mich unterlassen und mich nicht mit Tränen kränken: es sind Provinzialtruppen hinter uns her, die Bauern haben es mir berichtet. Diesmal sind es nicht gekaufte Banditen, ja gewiß, jetzt seht ihr mich an. Aber ihr seid ohne Vertrauen in mich. Was ich nicht ausschäle wie einen Zwiebelkern, habe ich erlogen, und wenn ich in Zorn darum gerate, so werdet ihr mich noch eines Tages totschlagen. Wie viel Tage also, lieber Liu, liebe Schwester Liang, Bruder Gelbe Glocke, wird es noch dauern bis zur Großen, Großen Überfahrt? “
Juen war der ängstlichste von ihnen; seit dem Überfall schlief der Mann wenig, träumte wild und schrie im Schlaf; in der Gefahr selbst benahm er sich in der Regel auffällig sicher und flößte durch seine Haltung anderen Mut ein. Ihm schoß das Blut in den Kopf, als er von dem drohenden Angriff hörte; er rief die beiden Lius an: „Kann es da noch einen Widerspruch geben? Will denn einer Betrüger gegen die hunderte draußen heißen? Wir müssen uns beeilen, beeilen und nochmal beeilen. Das ist der Schluß der ganzen Unterhaltung. Was sitzen wir noch lange! “
„Lange sitzen wir,“ entgegnete Liang, „wer Angst um seinen Körper hat, soll in den Städten bleiben, Verse machen, in der Sänfte liegen. “
Juens hellfarbiges Gesicht wurde dick; sein Hals schien verschwollen, so kloßig und kehlig sprach er mit einmal: „Das Geschwätz von Weibern berührt den Gebildeten nicht. Ebenso wenig wie das Geheul erwachsener Männer eine ernsthafte Debatte aufhalten sollte. Es ist einer erregt, es ist einer nicht erregt; was macht das aus? Ihr sitzt da und sitzt bis zum Abend, und wenn die hunderte, die mit uns laufen, den Säbel zwischen den Schultern fühlen, ist es vorbei. Aber es soll nicht vorbei sein. Darüber habt ihr nicht mit Herumhocken zu entscheiden. Es ist meine Sache wie eure. Ma soll reden, Ma-noh soll Recht behalten. “
Er schwieg, weil ihn inzwischen schon das große Gesicht der Gelben Glocke angelächelt hatte auf eine so freundliche Weise, daß er beirrt seine Stimme sinken ließ und aufhörte.
Die Gelbe Glocke redete ihm zu: „Hör doch nicht auf zu sprechen, Juen; es verargt dir niemand, wenn du alles sagst, was dir auf dem Herzen liegt. “ Er schwang die Hände gegen Ma und Juen zum Gruße; sie erwiderten zögernd und höflich.
Liang saß zuletzt allein am Boden, blickte in das Gras. Das Dreierlein sprach sie mitleidig an; er hob sie auf; sie ging mit gesenkter Stirn auf Juen zu, vor dem sie tiefe Verbeugungen machte, bis er ihren Gruß erwiderte; dann senkte sie ihre schmalen Schultern vor Ma, den sie vor den andern umfaßte, redete mit trauriger Stimme: „Hilf, Ma-noh. Bring alles zu einem Ende. Du hast in jedem recht. Kein Gemetzel, laß das nicht geschehen. Rette wen du kannst, uns mit, mich mit. “
Nach einer Stunde zogen Ma und seine Vertrauten mit den fünf Boten der Dörfler ab; die Mehrzahl der andern Dörfler blieb im Kloster zurück, auf das Zureden des angesehenen Salzpfänners, der sie für die bedrohten Bündler sorgen hieß. Es zeigte sich unterwegs, daß die Gelbe Glocke sich noch nicht beruhigt hatte; in der Nacht, die man im Freien zubringen mußte, hörte man ihn stöhnen an der Seite Liangs, die ihn zu trösten versuchte. Morgens wich er unter einem Vorwand ab und kehrte nach dem Kloster zurück.
Man kam am nächsten Vormittag in ein Dorf, das größte dieser Gegend, in welchem der Pfänner sein Grundstück hatte. Rasch besichtigte Ma, was ihn interessierte, hörte Haufen Menschen an, auf Maultieren ritt man eine Weile durch neue Dörfer; Massen von Unbeschäftigten kamen aus den Häusern heraus, starrten den sonderbaren Zug an, fielen auf den Boden.
Vor Anbruch des Abends besprachen sich die Bündler kurz; man fieberte unter der Vorstellung, daß eben jetzt die kaiserlichen Soldaten das Kloster erreichten.
Dann trugen Maulesel die Erschöpften zurück; über hundert ihrer neuen Freunde begleiteten sie erregt; sie liefen durch das hohe Kao-liang; eine Rast von einer Stunde nachts gönnte man sich; frühmorgens näherte man sich dem See.
Ein blasser Flammenschein stand jenseits des Wassers. Man kam zu spät. Der Angriff auf das Kloster schon erfolgt; das Kloster in Brand gesteckt von den Soldaten. Hunderte umgekommen. Die Soldaten, von den zurückgebliebenen Bauern wenig aufgehalten, waren geflohen, nachdem sie sich bemüht hatten, die in Kapellen eingeschlossenen Schwestern aus dem Feuer zu retten. Sie waren wie Besiegte in abergläubischer Furcht Hals über Kopf davongelaufen.
Als Ma mit den wütenden Bauern durch das geborstene Tor eindrang, saß die Gelbe Glocke auf der Schwelle, rief Ma, der übergesunken an dem Hals des grauen Tieres hing, „Heil“ und „Triumph“ zu.
Ma schüttelte wortlos die Fäuste über ihm. Auch die schöne Liang wandte sich schluchzend von ihm ab.
Der weitere Verlauf ist bekannt. Die Gebrochene Melone verließ das Kloster, die Bevölkerung dieser Distrikte erhob sich gegen die kaiserlichen Beamten. Stürme auf die Gefängnisse, Vertreibung der Magistrate folgten, von den ungeheuren Liegenschaften verjagte man die Besitzer, verbrannte ihre Häuser. Tagelang stapelte dicker Rauch über den Gütern. Es wurden weder die Gräber noch Ehrenbogen noch Pagoden geschont.
Die ersten Manifeste ergingen von einem Komitee, dem der Salzpfänner präsidierte. Man erklärte darin die vertriebenen Besitzer ihres Eigentums für verlustig; die Herrschaft der fremden Mandschudynastie, der Tai-tsing, nannte man erschlichen, nicht volkstümlich und darum abgeschafft.
Nach Nordost dehnte sich der Aufstand rapid aus. Von hier stießen zwei Haufen von je dreihundert Mann, welche zu den Wahrhaft Schwachen Wang-luns gehörten, zu den Aufständischen, suchten nach den Brüdern, denen sie helfen wollten.
Von der zweiten Woche ab unterzeichnete Ma-noh alle Proklamationen, Anschläge und so weiter. Er schickte Boten in die nächstliegenden Städte, die nachts an die äußeren Mauern einen Brief Mas an den Kaiser Khien-lung anhefteten. Darin erklärte sich Ma-noh bereit, die Herrschaft der Reinen Dynastie anzuerkennen, sofern das gesamte im Aufstand befindliche Gebiet von der Zentralverwaltung gelöst und durch einen eigenen Fürsten verwaltet würde.
Nach einer weiteren Woche erfolgte der wichtigste Schritt: die besetzten Distrikte wurden zu einem geistlichen Land mit dem Namen „Insel der Gebrochenen Melone“ umgewandelt nach dem Vorbild von Tibet. Die Pflege der paradiesischen Hoffnungen wurde als die Aufgabe des neuen Staates bezeichnet. Ma-noh ernannte sich zum Priesterkönig dieses geistlichen Landes; eine Kommission von drei Männern stand ihm unter dem Namen der Gesetzeskönige zur Seite. In der einzigen mittelgroßen Stadt der besetzten Distrikte residierte Ma-noh. Hier wurden Pläne zur Befestigung der Insel entworfen, die Anlegung großer Doppelmauern mit Wachtürmen um das gesamte Gebiet, etappenweise Wachtürme auf allen größeren Landstraßen. Etwa tausend Mann der Ortsansässigen blieben unter Waffen, für die übrigen lagerten in der Hauptstadt Waffen.
Es gab zweierlei Bevölkerung auf der Insel: die alten Bewohner in ihren Häusern, Läden, auf den Äckern, Bergen, in den Obstgärten; und die Brüder und Schwestern, bei Tag tätig unter ihnen, im übrigen abgeschlossen von ihnen, viele in Hütten, die meisten auf den Feldern in der Nähe der kräftigen Bodengeister. Die Bündler erwarben keinerlei Besitz, schoben jeden Gewinn, der nicht dem Augenblick diente, der königlichen Kasse zu.
Die Zeit am Sumpfe von Ta-lou hatte an Reiz, Erregung und Glück das Erdenkbare gegeben. Hier auf der Insel war man geborgen. Es war ein Meisterstück Ma-nohs. Alle und jegliche Last hatte er der Gebrochenen Melone abgenommen; die Mauer, die er gewünscht hatte, umgab die Brüder und Schwestern lebendig. Der Weg der äußeren Befreiung seiner Anhänger, den er am Sumpf von Ta-lu eingeschlagen hatte, war zu Ende gegangen. Sie waren sicher vor Zerschmetterung durch das blinde Schicksal.
Ma-nohs Härte in dieser Zeit wuchs. Von dem Augenblick an, wo er Priesterkönig des Gebietes war, umgab ihn eine Strenge, die an Grausamkeit grenzte und den erfahrenen Schüler der asketischen Mönche erkennen ließ. Ma verwandelte sich nicht, sondern fand sich in dem Augenblick wieder, wo nur sein Wort galt. Das Feuer des Klosters, in dem Brüder und Schwestern vor seinen Augen verkohlt lagen, brannte in ihm nicht aus. Er empfand kein Rachegefühl, sondern nur die Empfindung, daß Dinge, die so eingeleitet waren, nicht läppisch enden durften. Er nahm keinen Rat seiner Vertrauten mehr entgegen. Das Mitleid für die Halbtoten, Angespießten auf den Höfen, in allen Korridoren tötete ihn fast. Er sank von dem Gipfel herunter, stand unter den armseligen, verwirrten, abergläubischen seiner Menschen, wand sich unter ihren Qualen, und war eins mit diesem Volk.
Keinen seiner Vertrauten kannte er mehr. Auf dem raschesten Wege strebte er danach, die Herrschaft an sich zu reißen, weil er fühlte, sonst der Verantwortung zu erliegen. Das Schicksal des ganzen Bundes war gleichgültig, wenn er erst alles für den Bund geleistet hatte, dann stand und fiel er gleichmütig mit den andern. Kein Feuer berührte ihn dann mehr.
Ma-noh, ein unkenntlicher Mann, saß auf dem Thron der Insel. Kein Götze konnte blinder blicken als er. Sein Glaube an das Westliche Paradies war vorher eingewickelt in ein Entrückungsgefühl, ein überschwengliches Sehnen; jetzt saß Ma ernüchtert da, hielt den Glauben mit eisernen Griffen gepackt vor sich hin. Er sehnte sich nicht nach diesem Paradies, er begehrte, heischte kalt den Eintritt für sich und seine Bündler. Es handelte sich nicht mehr um ein traumhaftes Gut, dem man sich langsam stufenweise entgegenhob, sondern um etwas Nahes, wie die enge Holzbrücke, über die er jeden Tag ging, zu der er ging, wann es ihm beliebte, etwas Erkauftes, etwas Gekauftes und zehnfach Überbezahltes, das ihm keiner vorenthalten konnte. Es war nicht mehr diskutabel, ob das Westliche Paradies real existierte oder nicht; die Ereignisse hatten es mit den notwendigsten greifbarsten Zeichen der Wirklichkeit ausgestattet.
In ihm aber irrte manchmal eine Angst auf und ab, daß er noch einen Preis draufzahlen müßte, daß durch irgendeinen Umstand noch ein Preis wie der vorige verlangt werden könnte, und darum verlangte er keine lange Dauer des Lebens mehr, sondern einen kurzen dringenden Beschluß, ja den raschen Untergang dieser Insel, die er mit dem Namen seiner Brüder und Schwestern geschmückt hatte. Er war durch seine Klugheit, Entschlossenheit, kraft der unheimlichen Einflüsse, die man ihm zuschrieb, Herrscher dieses Landes geworden, dessen Bewohner er verachtete, deren Berührung ihn anwiderte. Es bedeutete ihm eine Qual, daß er sich schmutziger Dinge bedienen mußte, um der Gebrochenen Melone zu helfen. In keiner Zeit war sein Haß auf Wang-lun so ständig gewesen, der dies alles hatte geschehen lassen und mit einer kleinen Bewegung seines Willens hätte verhindern können.
Ma diente in der ersten Zeit nach den Umwälzungen am Sumpfe von Ta-lou mehr seinen Bündlern, als er glaubte. Er hatte gedacht, sich zu sich selbst zurückzufinden aus dem Kram der täglichen Führerschaft. Aber erst der Klosterbrand leistete wirklich diese Zurückführung. Ma war wieder Einsiedler geworden, ohne daß er sich dessen in seiner Königsrolle bewußt wurde. Er gewann Fühlung mit den ihm entschwundenen Vorgängen auf dem Nan-kupasse. Durch seine Träume liefen die Zibetkatzen, saßen auf dem Buddharegale, Haufen großer Krähen erwarteten seine Brocken vor der Stiege; und Ma-noh wunderte sich über das Auftauchen der Erinnerungen. Der ungeschlachte Wang-lun besah sich die goldenen Buddhas, die längst zerschlagenen, fragte ohne Ende nach einer hundertarmigen Kuan-yin aus Bergkristall, deren Splitter in dem Mikanthustal Wanderern in die Sohlen schnitten. Gegen das Schicksal gab es keine Rettung als Nichtwiderstreben; das Gemetzel am Fuß des Gebirges, der Klosterbrand hatte alles wieder gezeigt. Ma fühlte, daß die Größe dieser Idee und die Frucht dieser Tatsachen über seine Kraft ging.
Die Bündler waren zusammengeschmiedet durch das Schicksal. Das Glück der Sommermonate leuchtete nicht mehr über ihnen. Des furchtbaren Ernstes ihres Bundes wurden viele sich erst jetzt bewußt. Ma strahlte eine finstere Glut aus, die sich ihnen mitteilte. Juen lag, bei den Kämpfen um die Güter erschlagen, unter der Erde. Die Lius schwiegen vor der Gewalt Mas. Die schöne Liang bebte beim Anblick des erstarrten Menschen und pries sich glücklich, ihm gefolgt zu sein. Die Gelbe Glocke war verschwunden.
Noch einmal zitterte der Körper des Bundes unter einer inneren Krankheit. In einem Dorfe, das kaum acht Li von der Hauptstadt lag, lebte unter den Gebrochenen Melonen ein junger fremdartig schöner Bruder, der, obwohl Kohlenbrenner von Beruf, eine beneidenswerte Feinheit seines Benehmens und seiner Hilfsbereitschaft zeigte. Er hatte, wie nicht wenig andere, seine Familie verlassen aus kindlicher Anhänglichkeit, wegen eines Gelübdes gegen einen wandernden Bruder, daß er selbst zur Gebrochenen Melone gehen würde, wenn der Bruder seinem kranken Vater hülfe. Nun war er, herausgerissen aus der vertrauten Umgebung, mit den andern auf der Fahrt zum Westlichen Paradies.
Aber er wurde durch eine hitzige Leidenschaft zu einer Frau in der Reinheit und Ruhe seiner Empfindung gestört. Diese Frau war zwar eine Schwester, aber sie rang noch mit sich, um ihren Geist sicher nach dem klar erkannten Ziel einzustellen. Von einer mädchenhaft weichen Schönheit, einer stets heiseren Stimme, träumerisch schielenden Augen, wurde sie aus dem Haus ihres Vaters zuerst neben einen vierzigjährigen groben Pelzhändler geführt, vor dem sie nach zwei Jahren floh, weil sie glaubte, daß er ihre Untreue entdeckt hatte. Der Mann holte sie zurück, sie hinterging ihn dann wieder und mußte nun ihre Heimatstadt verlassen. Sie war glücklich, bei den wandernden Brüdern und Schwestern unterzukommen, sie konnte der Wildheit ihres Leibes, unter der sie selbst litt, frönen, ohne Todesgefahr zu laufen; sie stieß schon fast ihre Begierden mit den Füßen.
Da begegnete sie jenem Kohlenbrenner; sie versagte sich ihm nicht, aber bald zog er sich von ihr zurück, begehrte sie nicht mehr; wurde finster. Er erklärte ihr eines Morgens, als sie an seinen dunstumgebenen Platz vor dem Dorf herunter kam und sang, daß er keinen Gedanken seit langen Tagen mehr nach den überirdischen Dingen trage, daß er sich quäle und sie bäte, bei ihm zu bleiben und ihm zu gehören. Die junge Frau verhüllte schon weinend, als er zu sprechen anfing, ihr wohlgeformtes Gesicht, denn sie wußte vorher, was er sagen würde. Als er aber ausgesprochen hatte, sah sie sich um, ob ihr keiner zuhörte, setzte sich an eine qualmende Stelle neben ihn, umhalste ihn, so daß neben seinem abgewandten glatten Schädel ihre vollen Wangen und ihre ungesättigten Lippen standen, und benetzte mit Tränen und Küssen seinen Zopf. Ob er nicht wüßte, daß er gegen die kostbaren Regeln verstoße mit seinem Wunsch, und was er zu tun gedenke, wenn man erführe, was er tat.
Nung drehte ihr langsam sein ovales Gesicht zu, das unter dem Schmerz alle Ebenmäßigkeit verlor; das, was geschehen sollte, wenn man ihn entdeckte, wisse er nicht; er wolle nicht gegen die kostbaren Regeln verstoßen, denn das wäre eine Sünde gegen seinen Vater; aber er wisse sich nicht zu helfen. Der ekelhafte Selbstmorddämon mit den weiten Hosen hätte ihn schon angefallen, diese Nacht und drei Abende zuvor. „Was soll man tun, liebe Schwester? Was soll dieser Bruder Nung tun gegen sich? “ Nun saßen sie still und ohne Überlegung in dem üblen Rauch; seine rußigen Hände griffen in ihre schwarzen, kunstvollen Haarwindungen.
Die junge Frau, obwohl um sich selbst besorgt, folgte ihm, wie er verlangte. Sie zog mit ihm in eine Wohnung zu dem Kohlenbrenner, der Nung beschäftigte. Der baumstarke, duldsame Mann warnte die jungen Leute, die ihm aber auswichen.
Inzwischen war das Jahr weit vorgerückt; die Bewohner der Insel rüsteten sich zum Ching-ming-Fest, dem Allerseelentag. Überall im Freien errichtete man Schaukeln, an denen bunte Schnüre wehten. Das welke Laub der Roßkastanien flatterte herum. Man häufte frische Erde auf die Gräber. Das übliche leckere Schmausen fing an. Auf allen Wegen gingen die Frauen mit Weidenkätzchen hinter den Ohren, um nicht als gelbe Hunde wiedergeboren zu werden. Die Männer stolzierten in den Alleen, saßen in den Teeschänken bei Würfel- und Dominospielen mit golddurchwirkten Jacken und Gürteln.
In der Nähe der Tempel für die Stadtgottheit lagen die Begräbnisstätten für die Dirnen; die Frauen der Gebrochenen Melone ließen dorthin nach der Stadt auch ihre Toten bringen in einem großen Stolz und Mitleid. Als sie nun — denn Ma-noh duldete das Beibehalten aller volkstümlichen Sitten — am Ching-ming-Feste morgens in Scharen auf den Friedhof strömten, begegneten der verliebten jungen Frau, die Nungs Freundin war, andere Schwestern am Eingang zum Dirnenbegräbnis, verwehrten ihr den Eintritt. Es fiel kein Schmähwort; die Schwestern bedeuteten ihr nur, daß sie sie nicht mehr zu sich rechnen könnten, seitdem sie wie eine Ehefrau mit Nung zusammenwohne.
Die Schwester lief in Scham nach Hause, erzählte Nung, dem die Knie zu zittern begannen, daß ihr Geist, wenn sie stürbe, keine Ruhestätte bei den andern Schwestern finde, weinte, daß sie aus dem Ring ausgestoßen sei, daß sie nicht mehr so leben könne und sie müßte zu den Schwestern zurück. Der Wirt, der lange gebeugte Kohlenbrenner, hörte ihr zu und brummte: „Das wird wohl so sein müssen. “
Nung von ihr allein gelassen, wirtschaftete ohne Bewußtsein tagelang zwischen seinen Kohlen und im Garten herum. Nachts warf er sich in Kleidern auf die Erde, sein Gesicht wusch er nicht, seine Eßschalen ließ er stehen. Er ging eines Morgens an die Mauer des Dirnenfriedhofs und wartete auf die junge Frau. Als sie am regnerischen Abend mit einem Bruder zusammen vorüberkam, — sie atmete schon wieder auf, weil sie sich nicht in grenzenloses Elend gestürzt hatte — fiel Nung sie an, stieß den Bruder vor die Brust, zerrte die Kreischende an den Zöpfen hinter sich her. Dorfleute rannten herzu, rissen die Schwester los, verprügelten den Mann.
Nung, ganz auf der falschen Bahn, rollte nun glatt weiter. Die kostbare Regel, die den Besitz einer Frau verbot, fiel noch manchem im Bunde schwer. Offen am Tage nach dem vergeblichen Angriff unter seinen vielen Freunden darüber redend, verstand er es, sie mit sich eines Sinnes zu machen. Arbeitskameraden aus dem Dorf gesellten sich hinzu. Man schickte, hinter einer Weidenpflanzung lagernd, einen Boten an Ma-noh, Abweichungen von der kostbaren Regel zu gestatten. Die drei Gesetzeskönige ließen den Boten ins Gefängnis werfen.
Verbohrt, die junge Frau zu besitzen, die in die Hauptstadt zu Ma-noh geflüchtet war, sammelte Nung in vier Tagen Anhänger aus Dörflern, denen er den König als unduldsam und gewalttätig schilderte, und aus Brüdern, die nicht besser waren als er. Sie rotteten sich morgens auf den Straßen der Hauptstadt zusammen, um Ma-noh zu ihren Forderungen zu zwingen. Aber der Priesterkönig und sein Beirat warnten Nung und hießen die Männer die Stadt verlassen und um sich sorgen.
Da drang der junge Nung, schmutzig, barfüßig, in zerrissenen Kleidern in das Jamen ein, das als Königspalast diente. An der Schwelle der offenen Tür stehend, während sein aufgelöster Zopf ihm von rückwärts über den Schädel wehte, rief er in den dunklen Saal hinein, in dem Ma mit den drei Gesetzeskönigen an der Wand saß, ob man die Wünsche bewillige oder er den Bogen spannen solle. Auf das Schweigen trieb er das erstemal einen Pfeil dicht über Mas Kopf in die Holzwand, beim zweitenmal durchbohrte er einem Gesetzeskönig den Arm, dann wurde er selbst von hinten in die Schulter getroffen. Der Pfeil zitterte im Fleisch, Nung brüllte. Die Bürger hatten auf den Straßen den größten Teil von Nungs lärmenden Anhängern vertrieben, das Jamen umstellt, ihn selbst mit einigen andern im Hofe eingeschlossen. Der um sich beißende Nung wurde in den Holzkragen gelegt, im Stadtgefängnis eingesperrt. Die Gesetzeskönige verurteilten ihn, als Ma teilnahmslos die Sache von sich abwies, zur Todesstrafe mit Zerstückelung.
Nung wußte, daß sein Geist verloren war. Er gebärdete sich als ein der Unterwelt zustrebender Dämon, schmähte Brüder und Schwestern, die ihm auf dem Wege zum Richtplatz vor der Stadt begegneten, lachte über seinen Vater, für den er sich geopfert hätte und höhnte auf der Totenstätte den heiligen Bund so, daß der Henker nicht die Strafe des verlängerten Todes üben konnte, sondern auf Drängen der empörten Zuschauer den Ruchlosen erdrosselte.
Die schwere Bestrafung und Vertreibung der beteiligten Brüder und ihrer Helfer folgte. Dieser Aufruhr und seine häßlichen tobenden Begleiterscheinungen brachen über die Gebrochene Melone wie ein schweres Unglück herein. Es kam manchen Bündlern vor, als sei ihnen verhängt, sich nach dem erduldeten Leiden noch selbst zu zerfleischen. Viele schlichen entmutigt herum, dachten an verzweifelte Flucht in die alte Umgebung draußen, waren sinnlos lebensüberdrüssig. Andere hielten den Aufruhr für einen Reinigungsvorgang, der einer jungen Sache nicht erspart bliebe, trösteten sich und die andern, versuchten heller zu blicken.